Blog
Willkommen auf meinem Blog. Im Blog werde ich euch regelmäßig (ca. 1x/Monat) an meinen Themen, die mich beschäftigen, teilhaben lassen und Weiteres von meinem Autorendasein berichten. Ich freue mich sehr über Kontakte mit meinen Leser*innen und lade gerne zu meinem Newsletter ein, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. 
Wer gerne mehr über das Schreiben und das Leben eines Autors wissen oder ein Thema vorschlagen möchte, über das ich einen Blog schreiben sollte, darf mich sehr gerne kontaktieren.
Hier die bisherigen Blogthemen zur Übersicht: Die Themen sind derzeit aufsteigend nach Datum sortiert.
Der aktuellste Blog dagegen ist (weiter unten) jeweils als oberster , also absteigend, vorhanden.
Themenreihe I: Ich als Autor
29.01.2024: Mein Autorenleben durch´s Jahr
17.02.2024: Der Beginn, meinen Traum als Autor zu verwirklichen
24.02.2024: Wie ich meinen Traum weiter verfolgte, Autor zu werden. Letzte Ergänzungen zum Autorendasein
04.03.2024: Sonderblog: Einsamkeit älterer Menschen der LGBTQ+- Community
29.12.2024: 2024/2025: (M)ein Jahr als Autor in der queeren Literatur
Themenreihe II: „Die bunte Welt der Vielfalt“:
10.03.2024 Was wäre, wenn sich ein Vater als schwul bekennt? Allgemeines, Erfahrungsberichte, Unterstützungsangebote.
17.03.2024: „Mein Vater sagt, er sei jetzt meine Mutter. Nun habe ich zwei davon“ Transgender: Allgemeines, Erfahrungsberichte, Unterstützungsangebote
30.03.2024 „Transition. Der Transmann. Definition, Verfahren, Behandlung“
21.04.2024 Transition. Die Transfrau. Definition, Verfahren, Behandlung“ Themenreihe: Aktuell Politisches/Relevantes
Themenreihe III: Gesellschaft/Politik:
12.05.2024 IDAHOBIT- Machst Du mit?
02.06.2024: Europawahl: Wählen gehen für eine bessere, solidarische und tolerante Zukunft- für uns alle. Ein Statement als queerer Autor für die LGBT+ – Gemeinschaft mit Migrationsgeschichte
Themenreihe IV: Queer recherchiert:
14.07.2024: Pinkwashing – entlarvt! Wie es die queere Community in Kunst und Kultur entlarvt
15.08.2024: Biologische Familie und Wahlfamilie- Wenn Wunschträume auf Realitäten treffen. Wie es die queere Community in Kunst und Kultur beeinflusst
12.09.2024: Rechtsdruck in Europa – Die Uhr tickt! Was tun als queere Community?
08.10.2024: Wokeness. Warum dieses Schlagwort so umstritten ist und wie ein Kampfbegriff zum (auch queeren) Schimpfwort wurde
26.11.2024: Gemeinsam Stark: Die bedingungslose und unaufhörliche Solidarität in Queerfamilien im transsolidarischen Kontext. Ein Blick auf die Sichtbarkeit in der Literatur
Themenreihe V: Queer alarmiert
20.01.2025: Zensur: Wie ist es um die Zukunft der queeren Literatur in Europa bestellt?
25.03.2025: Nie wieder 09./10. November 1938! Queerness im Judentum und jüdische Literatur
Wichtige Themen für’s neue Jahr
25.03.2025- Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu allen relevanten Themen, die mich über’s Jahr verteilt bewegen.
Heute: Queer alarmiert:
 Fahne vom Verein „Keshet“
Fahne vom Verein „Keshet“
Nie wieder 09./10. November 1938!
Queerness im Judentum und wo sie sich in jüdischer Literatur findet
Liebe Freund*innen, insbesondere ihr Begeisterte der LGBTQAI+ -Literatur,
als sich am 27. Januar dieses Jahres zum 80. Mal die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau jährte und weltweit der Opfer des Nationalsozialismus medial feierlich gedacht wurde, verfolgte ich aufmerksam und zutiefst bewegt die würdevolle, festliche Veranstaltung im Fernsehen. Bewegt deshalb, weil ich zum einen selbst jüdische Wurzeln habe und mit einem Juden verheiratet bin, zum anderen, weil auch ein Großteil unserer jüdischen Familienmitglieder der Barbarei der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Aus Gründen des eigenen Gedenkens und zur Ehre unserer Familie wie auch der weltweiten jüdischen Diaspora, ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass in meinen Geschichten jüdisches Leben und auch queere jüdische Charaktere vorkommen. Während der erwähnten Feierlichkeiten wurden unter anderem filmische Zeugnisse der Bücherverbrennung in der Reichskristallnacht gezeigt, die in mir neben dem Entsetzen die Frage aufwarfen, ob es eigentlich schon damals queere jüdische Literatur gab, und wie es heutzutage um sie und generell um jüdische Queerness bestellt ist. Dabei bin ich auf interessante, geschichtliche Hintergründe gestoßen und in der Literatur fündig geworden:
Vorab: Für fromme Juden gilt traditionell die Aussage aus dem Buch Levitikus: Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau; es ist ein Gräuel. Übersetzt: Praktizierte Homosexualität ist ein Verstoß gegen die Gebote der Thora und allen sonstigen jüdischen Schriften. Aus jüdisch- orthodoxer Sicht galten schon immer Homosexualität und jegliche queere Identität als verwerflich und widernatürlich. Modernes, liberales Judentum ist hingegen offener als orthodoxes. Dennoch bietet der Tanach (Sammlung sämtlicher jüdischer Schriften) eine der schönsten lesbischen Liebeserzählungen der Geschichte (Lesbischsein galt als geringerer Verstoß gegen das jüdische Gesetz als Schwulsein): Rut und Noomi. Wird der Text traditionell als Beispiel für Frauensolidarität ausgelegt, gilt er in der Praxis des Re-Readings oder Queer-Readings als eines der Beispiele für lesbische Repräsentation in den jüdischen Schriften. Queer-gelesen gilt auch die Erzählung von David und Jonathan im Buch Samuel als Zeugnis schwuler Liebe im Tanach.
Mit Blick auf die Ursprünge der queeren Kultur ist es dagegen um so überraschender, dass In der Kaiserzeit und Weimarer Republik, in der die erste queere Subkultur der Welt entstand, nicht nur jüdische Aktivist*innen, sondern ebenso jüdische Schriftsteller*innen die homosexuelle Emanzipationsbewegung maßgeblich vorantrieben. In einer großen Anzahl von queeren Zeitschriften waren aber direkte Bezüge zu jüdisch-queerem Leben auffallend selten. Da sie stets von Zensur bedroht waren, bedienten sie sich einiger Codes: die Farbe Lila, das Veilchen, der Freund und die Freundin; sie halfen stellvertretend von tabuisierter und kriminalisierter Liebe zu erzählen. Mal traten die biblischen Gestalten Esther, Joseph und Ruth als Vorfahr*innen queerer Lebensentwürfe auf, mal folgten die Geschichten ihren Protagonist*innen in die Bars, Fabriken und auch Synagogen der modernen Metropole Berlin. Auch Bezüge zum Judentum und Jüdischsein gab es oft nur in Andeutungen und Symbolen.
Vor 1933 gab es eine Reihe bekannter jüdischer Autorinnen, die in Deutschland gelesen wurden, darunter Else Lasker-Schüler, die bedeutendste expressionistische Lyrikerin ihrer Zeit, daneben Anna Seghers, 1928 mit dem Kleist-Literaturpreis ausgezeichnet, und Alice Behrend.
Trotz zahlreicher literarischer Erfolge von jüdischen Schriftstellerinnen jener Zeit waren diese, als Vertreterinnen der Neuen Frau, unterrepräsentiert. Nicht wenige veröffentlichten deshalb zunächst unter einem männlichen Pseudonym, was erfolgversprechender war. Mascha Kaléko, die in den 1920er-Jahren Bestseller-Autorin und ebenso bedeutende Vertreterin der modernen Lyrik war, arbeitete als Journalistin und hatte ihre erste Veröffentlichung in zahlreichen Zeitungen, etwa im Uhu (1924 bis 1934) oder in Die Praktische Berlinerin (1905 bis 1927), beides Publikationen des Berliner Ullstein-Verlags, die Berlin in den so genannten Goldenen Zwanziger Jahren prägten.
Gestoßen bin ich auf die Anthologie Queere jüdische Gedichte und Geschichten in homosexuellen Zeitschriften zwischen 1900 und 1932, die erstmals eine Bandbreite an Texten aus homosexuellen Zeitschriften dieses Zeitraumes sammelt und das Verhältnis von Queerness und Jüdischsein in den Blick nehmen. Sie erzählen von Bedrohungen durch eine von Homophobie und Antisemitismus geprägte Gesellschaft, aber immer auch von den utopischen Räumen, die nur der Literatur möglich sind. Von Janin Afken, Liesa Hellmann, Hentrich & Hentrich, Berlin, 2024, ISBN 978-3-95565-614-0.
Weitere bedeutende, unter ihnen auch queere Autoren der Weimarer Republik waren Franz Kafka, Kurt Tucholsky, Max Brod, Walter Hasenclever, Friderike und Stefan Zweig, Joseph Roth, Egon Erwin Kisch und Walter Benjamin.
Das Buch Magnus Hirschfeld und seine Zeit von Manfred Herzer (DEGRUYTER, Berlin/Boston 2017, ISBN 9783110547696) erzählt von Leben und Werk des jüdischen, sozialdemokratischen und schwulen Arztes Magnus Hirschfeld und Aktivisten (1865-1935), der bereits Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin die weltweit erste Emanzipationsbewegung der Homosexuellen initiierte. Ein wichtiges Buch, – auch für alle, die sich mit der Geschichte der Schwulenbewegung insgesamt auseinandersetzen wollen. (aus: Jürgen Wenke, https://www.stolpersteine homosexuelle.de/literatur, 2024).
Die NS-Zeit bedeutete aber ab 1933 für Jüdinnen und Juden, keine Werke mehr in Deutschland veröffentlichen zu dürfen. Die Shoah stellte für die Schriftsteller*innen eine Zäsur dar, die bis heute nachwirkt. Einige wenige der Überlebenden kehrten zurück und versuchten, sich – in der DDR oder der Bundesrepublik – eine neue Existenz aufzubauen.
Aus der neuesten Zeit sind hervorzuheben: Der jüdische homosexuelle Schriftsteller Gad Beck leitete im nationalsozialistischen Deutschland eine Widerstandsgruppe und erlangte in Deutschland 1996 Bekanntheit, als er seine Autobiografie Und Gad ging zu David. Die Erinnerungen des Gad Beck 1923 bis 1945 veröffentlichte, für Comicfans inzwischen auch als kostenloser Web-Comic zu lesen. Darin erzählte er erstmals die Geschichte von Manfred Lewin, seiner ersten großen Liebe. Übrigens: Im Jahr 2000 wurde sie auch erfolgreich in den USA veröffentlicht unter dem Titel: An Underground Life: The Memoirs of a Gay Jew in Nazi Berlin.
Ebenfalls queer: Schmuel Yoseph Agnon, gehört zu den wichtigsten hebräischen Prosaschriftstellern des 20. Jahrhunderts. Seine ganz eigene Erzähltechnik und Sprache wurden oft mit Thomas Mann und Franz Kafka verglichen. Er erhielt 1954 und 1958 den Israel-Preis für Literatur und wurde 1966 mit dem Nobelpreis für Literatur für seine tiefgründige charakteristische Erzählkunst mit Motiven aus dem jüdischen Volk ausgezeichnet (Wikipedia).
Benny Ziffer, jüdischer Journalist, Literaturchef der israelischen Zeitung Haaretz und Schriftsteller mit: Ziffer und die Seinen, schrieb eine Komödie über ein schwules Paar, gespickt mit harten Kontrasten. Salzgeber, Berlin, 2009. Obwohl Ziffer eine Schrumpfung zeitgenössischer, bedeutender, jüdischer Autoren beklagt, ist festzuhalten, dass eine große Vielfalt an Stimmen der zeitgenössischen jüdischen Literatur die vielfältigen Erfahrungen jüdischen Lebens in der modernen Welt widerspiegelt und eine große Bandbreite an Themen, Stilen und Formen bietet. Autoren wie Amos Oz, Nicole Krauss, Jonathan Safran Foer und Michael Chabon sind hier für ihre persönlichen und doch universell wirkenden Werke bekannt geworden.
Für Neugierige unter euch habe ich eine queer-jüdische Bücherkiste ausgegraben: https://keshetdeutschland.de/de/queeres-und-juedisches-material. Darunter erscheinen mir besonders lesenswert: Maurits de Bruijns, queer-jüdisch autobiografische Erzählung Wie ich merkte, dass die Shoah nachts an meinem Bett steht, die die Verantwortung der Nachgeborenen thematisiert, erschienen bei Worten & meer, Hiddensee, 2023, ISBN 978-3-945644-36-2.
Wer unter euch jiddische Lyrik und Poesie mag, der stöbere beispielsweise unter: Irene Klepfish: https://jwa.org/encyclopedia/article/klepfisz-irena/
Außerdem empfehle ich folgende aufschlussreichen Bücher über heutiges, queeres Leben in Israel: Queer in Israel , herausgegeben von Nora Pester, Hentrich und Hentrich, Berlin, 2019 mit 84 Fotografien, 1. Auflage, ISBN 978-3-95565-282-1. In diesem prallen (und schönen!) Buch erfährt man Interessantes zur rechtlichen Situation von Schwulen, Lesben und Queers in Israel, über queere Familienmodelle und Elternschaft, queeren Zionismus, LGBTIQ* in der Armee und Persönliches über den Fotografen. Unbedingt lesenswert!
Mit Kosmos Tel Aviv stellt Marko Martin ein facettenreiches und widersprüchliches Israel vor, der vor allem mit dem Roman Der Prinz von Berlin im Jahr 2000 in der schwulen Literaturszene für Aufmerksamkeit sorgte. Zu guter Letzt und brandaktuell: Tanya Raab, die mit Shalom, zusammen als junge, jüdische Frau und Mutter zeigt, wie bunt und vielfältig jüdisches Leben ist und als solches sicher sein kann, Droemer-Knauer, München, 2025, ISBN: 978-3-426-28464-3.
Zum Abschluss sei ein besonderer Lichtblick genannt: Keshet, hebr.: Regebogen, der Verein der jüdischen LGBTQI*-Community in Deutschland, wurde als Verein (in Berlin) gegründet, um die Rechte von und den Umgang mit jüdischen LGBTIQ+ in Deutschland zu fördern und AGUDA, den israelischen Verband der Queer-Community und auch wie es mit palästinensischen Queers aussieht, öffentlich zu machen.
Mein Fazit: Die gesamte Liste jüdischer /jiddischer und queerer jüdischer/jiddischer Autor*innen aus früheren Zeiten wie auch auf dem aktuellen Buchmarkt ist so ungemein lang und vielfältig, dass ich lediglich wenige Beispiele vorstellen konnte. Durchweg sind ihre Werke lehrreich, scharfsinnig, kommen in vielen Facetten daher und sind oftmals von hohem, literarischen Wert und allesamt ein bedeutendes Zeugnis dafür, dass sich nie wieder die Nacht vom 9/10. November 1938 wiederholen darf!
Es ist für mich als queeren Autor unverzichtbar und inspirierend, mich mit der vor allem zeitgenössischen jüdischen Queerness und Literatur zu befassen, ist sie doch untrennbar und ein selbstverständlicher Teil unserer LGBTQAI-Community.
In diesem Sinne: Shalom, und bleib mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog, ich freu mich drauf!

Tschüssi
Dein Samuel
Wichtige Themen für’s neue Jahr
20.01.2025- Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu allen relevanten Themen, die mich über’s Jahr verteilt bewegen.
 Heute: Queer alarmiert:
Heute: Queer alarmiert:
Wie ist es um die Zukunft der queeren Literatur in Europa bestellt?
Wird sie immer mehr einer Zensur und einem «Maulkorb« zum Opfer fallen?
Liebe Freund*innen , insbesondere ihr Begeisterte der LGBTQAI+ -Literatur,
noch in meinem letzten Beitrag habe ich geschrieben: «Die queere Literatur ist so wunderbar lebendig, und ich könnte nicht aufgeregter sein, ein Teil dieser wunderbaren, teils ausgeflippten, überraschenden, tief emotionalen Erzählungen zu sein.„
Dazu stehe ich weiterhin und um ein Vielfaches mehr, nachdem ich in diversen Nachrichten über den Buchmarkt – initial über das Vorgehen durch den amerikanischen Präsidenten – etwas vernommen habe, das mich zutiefst entsetzt mit «das darf doch wohl nicht wahr sein!“ und mich gleichzeitig fassungslos auf die Palme bringt: Unsere Literatur, insbesondere die des queeren Genres, gerät zunehmend unter Kontrolle, und zwar weltweit, heißt auch in Europa! Das hat mich alarmiert, weil es für mich nicht nur die innere Sicherheit und die Demokratie gefährdet, sondern auch die Pressefreiheit infragestellt und letztlich auch das künstlerische Schaffen aller Autoren queerer Literatur. Außerdem erinnert es mich an jene Nacht des 9. Novembers 1938, in der alles Geschriebene einer ganzen Ethnie durch Flammen wie ungeschehen gemacht wurde. All’ das veranlasst mich, dieser Maulsperre etwas gegenzusetzen und hier einen kurzen Überblick darüber zu geben:
Vorweg: Ist es nicht so?: Queere Literatur kann helfen, sich und die eigene (queere) Sexualität besser einzuordnen, zu verstehen und zu akzeptieren, dadurch Ich-Stärkung zu erfahren und einen gesunden Selbstwert zu entwickeln, da hier von Menschen die Rede ist, die ähnliche Erfahrungen teilen und die gleiche Sprache sprechen, so dass man sich als Leser*in weniger allein fühlt oder sich dazu ermutigt sieht, sich gegen Ungerechtigkeit, Diskriminierung oder gar Hass zu wehren oder entsprechende Hilfe einzuholen. Außerdem kann sie dazu beitragen, nicht-queeren Menschen zu ermöglichen, die eigene sexuelle Identität zu hinterfragen, ihnen die Welt der LGBTQAI+ -Community durch lebendige Erzählungen näherzubringen und erlebbar zu machen, so dass letztlich Vorurteile abgebaut werden oder gar Sympathien entstehen können, ganz egal, ob es sich dabei um Ratgeber, Entwicklungsromane, Gay Romance, Biografien, Sachbücher, Fantasy oder Krimis/Thriller o.a. handelt. Sichtbarkeit ist für heranwachsende Menschen enorm wichtig. In Büchern finden viele Kinder und Jugendliche Zufluchtsorte und Held*innen, mit denen sie sich identifizieren können. Gerade für queere Menschen ist dies besonders wichtig. In einem ZDF-Interview erklärt der britische Autor George Lester, dass ihm während seiner Jugend eine literarische Identifikationsperson gefehlt habe. Für ihn habe sich sich seine Welt verändert, nachdem er zum ersten Mal einen queeren Roman gelesen hatte. «Ich konnte in einem Buch jemanden sehen, der so war wie ich, und das bedeutete mir alles», so Lester. Denn nicht jede*r kennt eine andere queere Person und kann sich dementsprechend austauschen.
Queere Autorenkolleg*innen konnten mit Freude erleben, dass in 2022 die Frankfurter Buchmesse durch die Verleihung des Buchpreises an die erste non-binäre Person Kim de l’Horizon für deren Werk «Blutbuch« ein Statement für die Sichtbarkeit der queeren Community gesetzt hat. Auch in den beiden darauffolgenden Jahren gab es bemerkenswerte literarische Buchveröffentlichungen queerer Autor*innen, die national und international Anerkennung gefunden haben, man denke an Pedro Lemebel: «Torero, ich hab Angst« («ein queeres Meisterwerk« laut queer.de/Jahresrückblick 2023) oder Angelo Tijssens: «An Rändern« («der beste queere Roman des Jahres« ebd., Jahresrückblick 2024).
Demgegenüber verrät ein Blick in die Literaturgeschichte, dass in ihr die Darstellung von Homosexualität beziehungsweise des homoerotischen Begehrens eine lange Tradition hat, und mindestens genauso lang sind die Versuche, diese Darstellungen zu zensieren: Bereits 521 vor Christus mussten die Dichter Ilbycus und Anareon aufgrund der Thematik ihrer Texte vor den Persern flüchten. Unter der Diktatur der Nazis wurden sogenannte gleichgeschlechtlich veranlagte Männer zu Staatsfeinden erklärt, und Heinrich Himmler befahl deren Einweisung in Konzentrationslager und ihre Ermordung. So ist es wenig verwunderlich, dass «Die Freundesliebe in der deutschen Literatur« von Hans Dietrich aus dem Jahre 1931, «wohl eine der ersten literaturwissenschaftlichen Arbeiten zur Homosexualität in der Literatur (laut «booklooker.de«) als erstes Buch über eine homosexuelle Liebe, ein Opfer der Bücherverbrennung wurde. Aber auch außerhalb von Diktaturen kam es durchweg zur Zensur durch Akteure im Literaturbetrieb und der Rezipienten in der Literaturwissenschaft und der Literaturkritik. Das Thema Homosexualität war auch in der Literaturwissenschaft lange mit einem Tabu belegt. So wurden auch bei Vertreten der Weltliteratur Motive, Fragestellungen und sogar ganze Werke in der Forschung schlichtweg ignoriert! Beispielsweise fand in Frankreich Zensur auch durchaus in Form von Übersetzungen amerikanischer Romane durch die Publikationshäuser statt. So wurde die spezifische Sprache des Textes, die als Signal für die Zugehörigkeit der schwulen Subkultur diente, abgeschwächt. Nicht erst seit der Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre und der Stonwall Revolte in den USA, hat es emanzipatorische Versuche der Schwulenbewegung gegeben, doch diese haben jedoch nicht zu einem Ende der Zensur geführt: Das 1970 erschienene Werk «Eden, Eden, Eden« von Pierre Guyotat wurde in Frankreich trotz Protestbekundungen von Barthes, Genet, Foucault und Derrida ganze elf Jahre zensiert!
Wir sehen: Die Zensur der schwulen Literatur ist vielfältig: Ob durch Verschweigen, gesellschaftliche Ächtung, Verbote oder auch Änderungen in den Übersetzungen, queere Literatur war in der Vergangenheit nur schwer bis gar nicht zugänglich. Zwar hat sich spätestens seit den späten 1960er mit den Stonewall-Aufständen in den USA und den Studentenprotesten in Europa gesellschaftlich viel getan, dennoch gibt es auch in der westlichen Gesellschaft immer wieder Versuche, schwule Literatur zu zensieren. Bücher mit homosexuellem Inhalt sind auch in der Gegenwart oft umstritten, und in anderen Teilen der Welt zeichnet sich in Hinsicht queerer Literatur ein beängstigendes Bild ab:
Der Kulturkampf hat in den Vereinigten Staaten die öffentlichen Bibliotheken erreicht. Die Vereinigten Staaten, ein Land, das traditionell als Verfechter der Meinungsfreiheit gilt, sieht sich einem wachsenden Problem der Zensur gegenüber. Laut der American Library Association (ALA) stieg die Anzahl der angegriffenen Bücher im Jahr 2023 um satte 92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Eltern, Aktivisten und immer häufiger auch Politiker verlangen die Zensur bestimmter Publikationen, sie wollen kontrollieren, was ausgeliehen und gelesen werden kann – und was nicht. Bibliothekarinnen und Lehrer*innen sehen sich gezwungen, die betroffenen Bücher entweder mit Stoffen zu verhängen oder diese ganz aus den Büchereien zu entfernen. Jene Werke behandeln LGBTQ-Thematiken oder enthalten People of Color als Protagonist*innen. Gerade in ländlichen Gegenden in den USA wird vermehrt versucht, queere Inhalte aus Bibliotheken und Schulen zu entfernen. Queere Inhalte könne man mit «Pornos in Schulen» gleichsetzen, jene Bücher enthielten «sexuell explizite», «schädliche» und «altersunangemessene» Inhalte – so empfindet zumindest der texanische Gouverneur und viele weitere Gleichgesinnte. Unter ihnen zahlreiche Eltern. Bücher als Quelle gefährlichen Denkens, vor denen es Kinder zu schützen gilt – so argumentieren vor allem Republikaner. Donald Trump geht sogar seiner kürzlichen Erklärung nach so weit, dass er transfeindliche Gesetzeserlasse mit weitreichenden Auswirkungen auf den Weg bringt, um «dem Genderwahnsinn ein Ende zu setzen, denn in Amerika gibt es nur Männer und Frauen«. Wer traut sich da noch in den USA, schriftlich über gender- bzw. queere Themen seine Stimme zu erheben? Ein Lichtblick: PEN America, der New Yorker Publikumsverlag Penguin Random House und eine Gruppe von Autorinnen haben sich mit Eltern und Schüler*innen der Escambia County Schule in Florida zusammengeschlossen mit dem Ziel, eine Bundesklage gegen die Buchverbote einzureichen. Denn diese Verbote gefährden ihrer Haltung nach die Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung sowie die Entwicklung junger Menschen.
England: Die «Heartstopper»-Autorin Alice Oseman äußerte sich via Instagram zu diesem Thema: «Rassismus, Homophobie und Transphobie gedeihen unter dem Deckmantel der Sorge um Kinder. Das ist auch nicht nur ein Problem der USA. Wir erleben genau dieselbe Sorge hier im Vereinigten Königreich.» Auch in Ungarn darf der queere Comic nicht angeboten werden. Eine ungarische Buchhandelskette muss laut Deutscher Presseagentur mit einer Geldstrafe von 32.000€ rechnen, da sie «Heartstopper» anbietet.
Ungarn: In Ungarn wird Homosexualität fälschlicherweise mit Pädophilie gleichgesetzt! Ministerpräsident Orbán und seine Fidesz-Regierung gelten wegen ihrer gender- und homophoben Ideologie als Sonderfall in der Europäischen Union. Die Europäische Kommission verklagte Budapest im Jahr 2022 sogar wegen eines Anti-LGBTQ+-Gesetzes, das als „Kinderschutzgesetz“ bekannt ist. Das umstrittene Gesetz aus 2021 enthält gleichzeitig ein Register für pädophile Sexualstraftäter nach US-amerikanischem Vorbild und ein Verbot nach russischem Vorbild, Minderjährige im Rahmen der Sexualerziehung und der allgemeinen Darstellung in Bildung, Medien und Werbung der sogenannten LGBT+-Propaganda auszusetzen. Man stelle sich vor: In Ungarn müssen queere Bücher in Bibliotheken und Buchhandlungen verdeckt werden. Hier begann die Buchhandelskette Libri, Bücher mit entsprechenden Inhalten in Klarsichtfolie einzuschweißen, um das Durchblättern dieser Werke zu verhindern. Hierbei beruft man sich auf das kontroverse, oben genannte «Kinderschutzgesetz«.
Russland: In russischen Buchhandlungen und Bibliotheken sind in den letzten Monaten viele Bücher aus den Regalen verschwunden. Bücher von Regimegegner*innen, die die russische Regierung zu „ausländischen Agenten“ erklärt hat, werden teilweise noch mit Packpapier eingewickelt und mit Warnhinweisen versehen angeboten, während Romane und Sachbücher, die sich mit queeren Themen beschäftigen, so gut wie gar nicht mehr verkauft werden. In den Bibliotheken kursieren Listen mit unerwünschten Titeln, die ausgesondert werden, und Buchhändler*innen schicken Tausende Bücher an die Verlage zurück. Das liegt nicht nur daran, dass vormals beliebte Autor*innen nun vom russischen Staat zu Verräter*innen erklärt werden oder – wie im Fall des international bekannten Bestsellerautors Dmitry Glukhovsky – per Haftbefehl gesucht werden, weil sie den Krieg gegen die Ukraine kritisieren. Sondern der härteste Schlag, den die russische Regierung dem kulturellen Leben im Land versetzt hat, ist ein neues Gesetz, das seit Anfang Dezember 2022 die Verbreitung von „Propaganda nichttraditioneller Beziehungen, Geschlechtsumwandlungen und Pädophilie“ verbietet. Da der Begriff „nichttraditionelle Beziehungen“ in Russland alles meint, was nicht hetero ist, ist davon auszugehen, dass das Gesetz einem vollständigen Verbot queerer Inhalte gleichkommt. Betroffen sind davon nicht nur Bücher, sondern auch Filme, Serien und sämtliche Print- und Onlinemedien. Die Zahl der Bücher, die potenziell von dem Gesetz betroffen sind, ist also sehr hoch.
Mein Fazit: Bücher waren schon immer mehr als nur bedrucktes Papier – sie sind Träger von Ideen, Vermittler von Wissen und oft auch Katalysatoren für gesellschaftliche Veränderungen. Dies führte zu Zensur, Verboten und sogar Bücherverbrennungen. Heute, in einer Zeit, in der die freie Meinungsäußerung als fundamentales Recht gilt, erleben wir eine beunruhigende Renaissance der Zensur, insbesondere von queerer Literatur in demokratischen Ländern. Die globale Zensur ist ein wachsendes Phänomen, die es einzudämmen gilt. Ich sehe in ihr letztlich Versuche, Bücher zu verbieten und Autoren zum Schweigen zu bringen, die Menschen inspirieren wollen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und Solidarität in einer Zeit zunehmender queerfeindlicher Gewalt auf allen Ebenen zu zeigen. In Deutschland dürfen wir zum Glück im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern nicht nur auf einen queeren Verlag schauen, wie beispielsweise dem bekanntesten unter ihnen dem «Querverlag«, der sich auf LGBTQ-Literatur spezialisiert hat seit nahezu 30 Jahren. Er präsentiert selbstbewusst seine Themen, auch auf den gängigen Buchmessen. Neben diesem findet ihr hier eine Auflistung weiterer: https://www.verlagederzukunft.de/pride-fuer-leseratten-und-buchliebhaberinnen/, und es stellen sich auch mittlerweile weitere Verlage diverser auf. Nur das kann helfen, Diskriminierung zu reduzieren und uns queeren Autor*innen Sichtbarkeit durch einen Platz auf den Büchertischen und in den Bibliotheken zu beschaffen.
Ich jedenfalls freue fühle mich nun mehr denn je verpflichtet, mich nicht einschüchtern zu lassen, sondern diesem Genre mit all’ meiner Schreibkunst treu zu bleiben, eben weil ich der queeren Community – ohne Angst vor freien Gedanken – meinen ungebrochenen Respekt zollen will. Lasst uns miteinander dafür einstehen, dass sich der Buchmarkt langsam verändert und immer öfter vielfältige Perspektiven – gerade in den Ländern mit «Maulkorb-Gebot« – abbildet.
Bleibt mutig und stark! Lasst uns verhindern, dass es in Deutschland so weit kommt wie in den aufgezeigten Beispielen. Und solidarisch mit unseren Autorenkolleg*innen der oben erwähnten und aller unerwähnten Länder und Staaten, deren Werke ihrer Sichtbarkeit durch Fesseln und Maulkörbe genommen werden.
Bis zum nächsten Blog im März (Februar fällt aus!), ich freu mich drauf!

Tschüssi
Dein Samuel
Jahreswechsel - Stimmungswechsel über’ s Neue Jahr
29.12.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu allen relevanten Themen, die mich über’s Jahr verteilt bewegen.
Queer bilanziert: 2024/2025: (M)ein Jahr als Autor in der queeren Literatur

Liebe Leser*innen , liebe Autor*innen-Kolleg*innen,
während ich beim ersten Schneegestöber in Berlins Winter an meinem Schreibtisch sitze, die zuletzt bearbeitete Seite meines neuesten Manuskripts umblättere, mit der duftenden Tasse Weihnachtstee in der Hand, lasse ich die vergangenen Monate Revue passieren:
Wie oft im alten Jahr fühlte ich mich wie ein Kapitän, der seine Reise mit einem Blick auf das weite, unentdeckte Meer wagt. Und dieser lästige Gast, der innere Kritiker! Er war wie ein regelrechter Stalker, der immer wieder an meine Tür klopfte und fragte: „Sind das wirklich die besten Worte, die du dir in 2024 leisten kannst? Ich dachte, Du bist ein Wortakrobat und kein Langweiler!“ Er schob sich in die Runde, über mein Manuskript lehnend, während ich versuchte, die Tastatur zu verteidigen, als ob sie der heilige Gral des Schreibens wäre. «Deine Charaktere sind flach wie frisch gebügelte Bettlaken!“ Während ich dann darüber nachdachte, ob ich meinen Laptop anschreien sollte, sagte ich mir immer wieder: «Vergiss nicht: Dein Kritiker darf seinen Platz in diesem Abenteuer haben, aber er ist nicht der Kapitän deines Schiffs! Nichts würde ihn mehr ärgern, als in einer fesselnden Geschichte über alle seine eigenen Unzulänglichkeiten gefangen zu sein! Er wird schon sehen, wenn irgendwann im neuen Jahr mein neuester Roman in den Regalen stehen wird und meine Leser*innen ihn lieben werden – so wie viele der anderen Autorenkolleg*innen meines Genres.“
Durchstöbere ich die Veröffentlichungen queerer Geschichten aus dem Jahr 2024, so gab es einen Wendepunkt für das queere Genre: Die Seiten der LGBTQAI- Literatur haben sich zunehmend mit Farben gefüllt, die vielschichtiger und authentischer sind als je zuvor. Auf der Leipziger Buchmesse zum Beispiel wurde ein queer-feministisches Fantasy-Magazin «Phantastik« vorgestellt, „Queer-Welten“ veröffentlicht Kurzgeschichten, Gedichte, Illustrationen und Essaybeiträge, die laut eigener Aussage marginalisierte Erfahrungen und die Geschichten Marginalisierter in einem phantastischen Rahmen sichtbar machen sollen. Es gab dort auch eine lesbische Büchernacht mit Queer-Party, Lesungen und Gespräche über Diversität auf dem Buchmarkt. Viele Verlage und auch Selfpublisher*innen veröffentlichen bereits Bücher, in denen Vielfalt gelebt und Queerness thematisiert wird. Doch queere Literatur ist mehr als ein homosexueller Charakter im Manuskript! Und siehe da: Es gab sie sehr wohl in 2024, diese Meister der Wortakrobatik und Ideen innerhalb der queeren Literatur, und allesamt haben offenbar ihre inneren Kritiker besiegen können. Sie haben Shakespear’s Ausspruch begriffen und seine Botschaft produktiv umgesetzt: «Wir wissen wohl, was wir sind, aber nicht, was wir werden können!“ Sie haben entdeckt, was sie werden konnten! Mit fantastischen Ergebnissen: In der Welt der Bücher, in der ich lebe, hat ein wunderschöner Regenbogen aus bewegenden, fantasievollen, aufreibenden, aber auch humorvollen Geschichten, Stimmen und Erfahrungen seinen Platz gefunden. Autoren, die einst im Schatten standen, haben das Licht gewittert und ihre Perspektiven in kraftvoller Prosa und Lyrik verpackt. Ich habe mit einigen dieser Talente in diesem Jahr in Kontakt treten dürfen und habe von ihrem Mut, ihrer Verletzlichkeit und ihrem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Geschichten im LGBTQAI-Genre gelernt.
Einer der herausragendsten Autor*innen des Jahres ist für mich definitiv Aleksandar Hemon: Sie hat mit „Die Welt und alles, was sie enthält“ eine tragische Liebesgeschichte zwischen zwei Männern erschaffen, einen großen Roman über Liebe, Krieg und Emigration: Pinto ist ein jüdischer Apotheker aus Sarajevo, der sich im Schützengraben des Ersten Weltkrieges in Osman verliebt. Hemon erzählt ihre tragische Geschichte über mehrere Jahrzehnte und Kontinente. Ihre ergreifende Erzählung über die Suche nach Identität und Selbstakzeptanz in einer unbarmherzigen Welt verbindet Realität mit Poesie und lässt die Leser mit einem Gefühl der Hoffnung zurück. Sie hat die Fähigkeit, mit scharfer Beobachtungsgabe und gleichzeitig zärtlicher Sprache die Kämpfe und Triumphe ihrer Charaktere zu entwickeln. In dieser Geschichte treffen wir auf Verletzlichkeit und Stärke, und ich kann nicht anders, als in beiden etwas von mir selbst wiederzuerkennen.
Ein weiterer Stern am queeren Literaturhimmel ist Danny Ramadans «Nebelhorn-Echos«: Der syrisch-kanadische Autor und LGBTQIA*-Aktivist erzählt in seinem Roman die tragische Liebesgeschichte von zwei jungen Männern in Syrien. Er zeigt den Kampf gegen die Konventionen einer homophoben Gesellschaft, die Auswirkungen des Bürgerkrieges und die Flucht aus der Heimat. Syrien mal aus einem ganz anderen Blickwinkel, verstörend und bewegend.
Beachtenswert fand ich ebenfalls Katharina Scholz mit: «In den Hinterräumen«: Als junge lesbische Pastorin ist sie aus Schwerin in das kleine Moorstede gezogen. In ihrer neuen Gemeinde kommt Kalli Krause nicht unbedingt gut an. Dann stirbt ein Mädchen im Ort und bei dem Versuch, das Geheimnis um ihren frühen Tod zu lüften, gerät Kalli selbst in den Fokus. Sie muss erkennen, dass die mecklenburgische Provinz nach ihren eigenen Regeln tickt. Humorvoll und bezeichnend für klerikale Gegebenheiten fernab der Metropolen.
Im Bereich der Gay Romance hat mich Matthias Wailersbacher mit seinem Berlin-Roman «Nirgendwo und doch Zuhause« überzeugt. Erzählt wird die Geschichte von Raphael, der in Berlin wohnt und das süße Leben in der großen Stadt lebt. Doch oft fühlt er sich zwischen Fernsehturm und Brandenburger Tor fehl am Platz. Allerdings weiß er auch nicht, wo er stattdessen besser aufgehoben wäre. Er fühlt sich nirgendwo so richtig zu Hause. Als er sich dann auch noch auf eine Affäre mit seinem besten Freund Nils einlässt, gerät sein Leben komplett aus den Fugen. Ein schwuler Roman, der nicht von sexuellen Praktiken erzählt, sondern vom Leben bestimmt ist, ein tiefgründiger Selbstfindungsroman voller Emotionen, der nicht die üblichen Klischées bedient.
Last but not least hat mich: Jade C. Kleinods Roman: «In Love with my devilish designer« begeistert, an deren Release-Party ich per Zoom teilnehmen durfte. Jade erzählt von Adrian, einem Rockstar, der gerade die Karriereleiter hochklettert und von Kasper, einem extravaganten Modesdesigner. Eine rasante MM Rockstar Romance mit viel Action und Spice.
Während ich nun auf 2025 blicke, spüre ich eine wachsende Vorfreude. Welche Geschichten und Stimmen werden sich uns im kommenden Jahr offenbaren? Welche neuen Talente werden entdeckt, und welche zutiefst menschlichen Erlebnisse werden uns in der kommenden Zeit erreichen? Werden auch die gesellschaftlich-queer-relevanten Themen wie sexuelle Identitäten, Machtformen und Normen, Geschlechterrollen und deren Diskussion ihren Weg in den Literaturhimmel finden?
Dabei hat mich allerdings eine kürzlich erhaltene Nachricht nachdenklich gemacht: In dieser Woche hat ein Verlag beschlossen und öffentlich kundgetan, keine queeren Bücher verlegen zu wollen mit der Begründung, dass man sich mit «so etwas« nicht auskenne und «niemandem auf die Füße treten« wolle, ein Thema, das nun heiß diskutiert wird. Mit Recht, denn es stellt sich die Frage, ob man queere Literatur bei queeren Verlagen belassen sollte, weil sie sich auskennen und die «richtige« Zielgruppe haben, oder ist es diskriminierend, queere Bücher generell aus seinem Programm auszuschließen und eben nicht but zu sein (wie die Welt nun mal ist)?
Mein Ziel als queerer Autor ist es, emotionale Geschichten zu erzählen, um Resonanz in der gesamten Leserschaft zu erzeugen, den Dialog über Diskriminierung und Solidarität in der Gesellschaft zu fördern und Raum für identitätsstiftende Geschichten zu schaffen. Ich sehe es als meine Aufgabe, die Selbstverständlichkeit zu dekonstruieren und das Leben in seiner vollen Farbpalette abzubilden. Sollte daher queere Literatur gerade deswegen nicht nicht nur queeren Verlagen vorbehalten sein? Figuren queerer Romane sind ja nun auch, ob fiktiv oder nicht, Spiegelbilder realer Personen, die unsere Gesellschaft durchmischen. Wie auch immer.
Ich bin gespannt, wie sich die Verlagswelt mit queerer Literatur weiter entwickeln wird und davon überzeugt, dass wir hier noch viel mehr Sensibilität, Humor und Magie erwarten dürfen. Die Welt, in der ich schreibe, scheint sich ständig zu verändern – und damit auch die Erzähler, die uns zum Staunen bringen und zum Nachdenken anregen.
In den kommenden Monaten möchte ich meine eigene Stimme noch weiter schärfen, über meine Grenzen hinausgehen und neue Narrative entdecken- oder noch besser: kreieren. Ich bevorzuge Autor*innen, die danach streben, Geschichten zu erzählen, die nicht nur unterhalten, sondern auch inspirieren, heilen und verbinden.
Autor queerer Literatur zu sein erfordert eine ungeheure Geduld (nicht meine Kernkompetenz!), eine tiefe Empathie und ein feines Gespür für die Themen, Menschen und Geschichten, die uns in der Community umgeben. Doch die Herausforderung liegt darin, diese Idee in etwas Greifbares zu verwandeln. Es gilt, Fragen zu stellen: Welche Emotionen will ich wecken? Welches universelle Thema möchte ich ansprechen? Und wie kann ich mein Publikum – insbesondere die LGBTQAI -Community – erreichen und berühren oder sogar zu etwas bewegen?
Ich hoffe auf neue Perspektiven, neue Geschichten, die darauf warten, erzählt zu werden. Und ich sehe gebannt auf den Herzschlag der queeren Community, die sich weiterhin in all ihrer Vielfalt entfaltet -gegen allen Rechtsdruck.
Mein Fazit: 2025 ist unser Jahr! Auf ins neue Jahr, ihr wunderbaren Wortkünstler! Lasst die Tinte sprudeln und die Seiten fliegen! 2025 wartet auf unsere kreativen Wunder! Die queere Literatur ist so wunderbar lebendig, und ich könnte nicht aufgeregter sein, ein Teil dieser wunderbaren, teils ausgeflippten, überraschenden, tief emotionalen Erzählungen zu sein.
So begebe ich mich auf den nächsten Abschnitt meiner Reise, trinke weiter meinen Tee, während ich die nächsten Seiten meines Manuskripts mit meiner Vision fülle, mit Glitzer und Feenstaub, unerschrocken, neugierig und mutig, alle bekannten Stolpersteine dabei zu überwinden.
In diesem Sinne. Bleibt wach, mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog, lasst euch überraschen.

Tschüssi
Dein Samuel
Aktuell Politisches/Relevantes
26.11.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu aktuellen, gesellschaftlich/politisch relevanten Themen, die mich derzeit und immer wieder bewegen.
Queer recherchiert: Gemeinsam Stark: Die bedingungslose und unaufhörliche Solidarität in Queerfamilien im transsolidarischen Kontext. Ein Blick auf die Sichtbarkeit in der Literatur
Liebe Freund*innen,
der Monat November hatte es in sich: gleich am 01. Allerheiligen, am 02. Allerseelen, am 09. Gedenken an die Holocaust-Opfer, am 17. Volkstrauertag, dazwischen war Sankt Martin neben all’ diesen Trauertagen als rettender Heiliger halbbemantelt reingeritten, welch eine Erleichterung zum Durchatmen! Dann, am 20. November 2024, wiederholte sich der alljährliche «Trans* Day of Remembrance «, auch wieder aus einem traurigen Anlass: Es geht hier um Transfeindlichkeit, ein hochbrisantes Thema und von besonderer Bedeutung in unserer Welt, die oft von Vorurteilen geprägt ist. In einer Zeit, in der die Sichtbarkeit von trans* und genderdiversen Menschen und erschreckender Weise selbst die Zivilcourage gegen transfeindliche Gewalt mit dem Leben bezahlt werden können, darf auch ein Gedenken an die Opfer transfeindlicher Gewalt nicht untergehen! (Weitere Informationen zum TDoR findest Du hier: #trans #tdor #transdayofremembrance #erinnerung #WeRemember).
So vielfältig und bunt unsere Welt, so unterschiedlich ihre Haltung zu gesellschaftspolitischen Fragen, so erschreckend einfältig, dunkel und monoton, aber auch im wahrsten Sinne des Wortes spürbar die Positionierung eines wachsenden Bevölkerungsanteils mit seiner ablehnenden Gesinnung gegenüber identitärer Selbstbestimmung. Wusstest Du das? Unbegreiflich und grausam, dass allein seit 2023 zirka 350 Menschen wegen ihres Trans*-Seins, ihrer Nichtbinärität oder sogar wegen ihrer Zivilcourage ermordet wurden! Anfeindungen und Angriffe aus homo- und transfeindlicher Motivation sind bis heute häufig von besonders brutaler Gewalt geprägt. Allzu wenig finden Suizide Betroffener mediale Aufmerksamkeit, was genauso diskriminierend ist und den Eindruck erwecken könnte, es handele sich dabei um eine Nebensache, einen Kollateralschaden zugunsten des gesellschaftlichen Gemeinwohls. Mich macht so etwas unfassbar wütend, bin ich doch in meinem beruflichen Kontext tagtäglich mit solchen Personen unterwegs, die ich auf ihrem Weg begleite. Ich fühle mich beschenkt, darunter so viele Menschen kennenlernen zu dürfen, die mich durch ihr hohes Maß an Sozialkompetenz, Feinfühligkeit, Freundlichkeit, Tiefsinnigkeit und Kreativität berühren, aber genauso bin ich entsetzt und traurig darüber, wenn sie mir von ihrer Identitätssuche und -Findung und den anschließenden Diskriminierungserfahrungen erzählen, die sie zu Selbstzweifeln, Selbstabwertung und mangelnder Lebensfreude bis hin zur Suizidalität treiben. Transfeindliche Diskriminierung oder das erzwungene Verbergen der eigenen Geschlechtsidentität kann die Gesundheit von trans* Menschen erheblich beeinträchtigen. Dies bestätigen aktuelle Forschungsergebnisse, siehe Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (2021): „Geringere Chancen auf ein gesundes Leben für LGBTQI*-Menschen.“ S. 88. In: DIW-Wochenbericht, Nr. 6/21. von https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.810350.de/21-6-1.pdf
In unserer Gesellschaft existieren trotz aller Aufgeklärtheit in unserer Moderne immer noch weit verbreitete (auch religiös und ideologisch bedingte) normative Vorstellungen davon, wie sich ein Mensch gemäß seiner sichtbaren (vermeintlichen) Geschlechtsidentität zu kleiden hat, was er anzuziehen hat, damit es andere nicht stört, wen er sexuell begehren darf und am Ende gar zu lieben, zumindest zu heiraten hat. Welch ein Irrsinn! Dahinter stehen Vorstellungen eines biologischen Geschlechtes als entweder eindeutig männlich oder eindeutig weiblich, von dazugehörigen, tradierten Geschlechterrollen, die ein sogenanntes angemessenes Verhalten festlegen. Heterosexualität wird gesehen als die einzige akzeptable und gesellschaftskonforme Ausgestaltung, auch romantische Beziehungen zu führen. Menschen, die diesen Normen nicht entsprechen, werden in allen gesellschaftlichen Bereichen oftmals ausgegrenzt. Diese Abwertung begründete eine lange Geschichte von Diskriminierung bis zur systematischen Verfolgung und brutalen Gewalt.
Nicht zu vergessen:
- Auch während des Nationalsozialismus wurden Schwule, Lesben und Trans- Personen verfolgt und ermordet.
- Man bedenke, dass der Paragraf 175 STGB, der im Deutschen Kaiserreich 1871 eingeführt und „widernatürliche Unzucht“ zwischen Männern unter Strafe setzte, erst 1969 geändert wurde, wonach homosexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern über 21 Jahren straflos wurden. Erst 1994 beschloss der Bundestag die endgültige Streichung dieses Paragrafen.
- Bis in das Jahr 1992 wurde Homosexualität als Krankheit durch die Weltgesundheits-organisation (WHO) eingestuft.
Seither hat sich etwas verändert:
- Laut LSVD bezeichnen sich nach einem Kinder-und Jugendbericht der BzGA beachtliche 9% aller 14 – 15-Jährigen als nicht ausschließlich heterosexuell, das sind etwa 1,25 Millionen Minderjährige unter 18 Jahren. Halte ich das für mutig? Angesichts der oben erwähnten, möglicherweise zu erwartenden Probleme, im ersten Impuls ja, aber im Grunde nein, sondern für ausgesprochen beneidenswert, ein aufrichtiges Statement von sich als Person abgeben zu können, egal wie letztendlich die eigene Orientierung verlaufen wird.
- Laut Statistischem Bundesamt haben sich im Jahre 2020 2.155 Personen einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen (trans* Frauen 1.462, trans* Männer 693), 2023 wurden in deutschen Krankenhäusern insgesamt 3.075 operative Geschlechtsumwandlungen durchgeführt. Diese Zahlen geben laut Deutscher Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. (dgti) allerdings kein vollständiges Bild wieder. Die Anzahl derer, die trans* sind, liegt demnach heutzutage höher. Angelehnt an repräsentative Befragungen in den USA geht die dgti von mindestens 0,6 Prozent Bevölkerungsanteil in Deutschland aus, Tendenz steigend.
Und es gab einen weiteren Lichtblick: Seit dem 1. November 2024 können das Geschlecht und der Name einfacher an die eigene Lebenswirklichkeit angepasst werden. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz wird das nicht mehr zeitgemäße Transsexuellengesetz abgelöst. Den Geschlechtseintrag und den Vornamen ändern – das ist mit dem Selbstbestimmungsgesetz von nun an einfacher: Die Anpassung kann durch eine Erklärung gegenüber dem Standesamt vorgenommen werden. Insbesondere trans- und intergeschlechtliche sowie nichtbinäre Personen profitieren davon, das Recht auf Achtung der geschlechtlichen Identität werde gestärkt, heißt es. Eine gerichtliche Entscheidung über die Antragstellung – wie nach dem bisher geltenden Transsexuellengesetz – ist künftig nicht mehr erforderlich. Auch die Notwendigkeit, zwei Sachverständigengutachten einzuholen, entfällt. Damit wird eine gesetzliche Vorgabe außer Kraft gesetzt, die von den Betroffenen häufig als entwürdigend empfunden wurde. Stattdessen reicht eine Selbstauskunft mit Eigenversicherung aus.
Und was sagt der Literaturhimmel dazu? Es gibt unzählige Fachliteratur, vor allem aus dem medizinischen Bereich, die ich aber hier vernachlässige. Stattdessen empfehle ich für alle, die sich mit der Thematik sachlich auseinandersetzen möchten:
Spektrum Kompakt : «Transgender«, , 11/2022, SAGA Egmont, Audible-Hörbuch
Fazit: Das eigene Selbst ohne Unterdrückung und Repressalien leben können.
- I. Osterkamp/F. Wünsch: «Trans* Personen: Zwischen gewollter und ungewollter (Un-)Sichtbarkeit Zwischen direkter und indirekter Diskriminierung, 08/22, Springer VS
Fazit: beschäftigt sich mit Auswirkungen symbolischer Gewalt im Leben von trans* Personen, die vor allem in Bezug auf ihre Transitionsprozesse thematisiert werden.
Die geschlechtliche Identität von Autor*innen spielt für die Repräsentation von queeren Menschen in der Literatur eine immer größer werdende Rolle. Daher hier noch 4 Buchempfehlungen von trans- und nichtbinären Autor*innen, die die Erfahrungen und Realitätern von Identitäten jenseits der cis-Geschlechtlichkeit beschreiben:
Kim de l’Horizon: «Blutbuch«,6/2023, DU Mont, Audible Hörbuch
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2022 und dem Schweizer Buchpreis 2022
Kim de l’Horizon macht sich auf die Suche nach anderen Arten von Wissen und Überlieferung, Erzählen und Ichwerdung, unterspült dabei die linearen Formen der Familienerzählung und nähert sich einer flüssigen und strömenden Art des Schreibens, die nicht festlegt, sondern öffnet.“ (perlentaucher)
Phenix Kühnert: «Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. über trans Sein und mein Leben«.
Phenix ermutigt und sensibilisiert. Denn: Menschen sind verschieden, nichts zu 100 Prozent, wir entwickeln und verändern uns, wachsen. Und dabei wird klar: Diversität ist die wahre Normalität.“ (Thalia)
Linus Giese: «Ich bin Linus. Wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war«, 10/2020, Lübbe Audio, Audible-Hörbuch
Seit seinem Coming-Out engagiert sich Linus für die Rechte von trans Menschen. Vor allem im Netz, aber nicht nur dort, begegnet ihm seither immer wieder Hass. Doch Schweigen ist für ihn keine Option.“ (perlentaucher)
Jayrôme C. Robinet: « Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund«, 02/2019, Hanser
Mitreißend erzählt er von seinem queeren Alltag und deckt auf, wie irrsinnig gesellschaftliche Wahrnehmungen und Zuordnungen oft sind.“ (Thalia)
Mein Fazit: Ich will «Transsolidarität« nicht nur zu einem Schlagwort erheben, sondern sie als einen kraftvollen Aufruf verstanden wissen, sich gegen Diskriminierung gemeinsam zu erheben. Bedingungslos und unaufhörlich!
Gott sei Dank sind Nikolaus und das Christkind – möglicherweise und wünschenswert sogar als Trans*Personen – im Anmarsch, so sich denn über ihre Jahrhunderte alle ihrer sexuellen Identität als selbstbestimmte Personen gewahr sind. Also Augen auf beim Geschenke einsammeln und lassen wir uns überraschen, vielleicht mit einem der o.g. Bücher- oder wir schreiben als kreative Autor*innen selber eine genreunabhängige Geschichte über Trans*, warum eigentlich nicht?
In diesem Sinne. Bleib‘ wach, mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog mit einer neuen Themenreise

Tschüssi
Dein Samuel
Aktuell Politisches/Relevantes
08.10.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu aktuellen, gesellschaftlich/politisch relevanten Themen, die mich derzeit und immer wieder bewegen.
Heute: Queer recherchiert: Wokeness. Warum dieses Schlagwort so umstritten ist und von seinem Einfluss auf die literarische Darstellung queerer Lebensrealitäten
Wokeness – ein Wort, das wie ein Blitzschlag durch die queere Community in Deutschland zuckend die Gemüter erhitzt. In einem Land, in dem Vielfalt in vielen – vor allem westlichen Teilen – gefeiert wird, ist es entscheidend, die Nuancen und Spannungen zu verstehen, die hinter diesem Begriff stecken. Von lesbischen und schwulen Perspektiven bis hin zu inter- und transidenten Lebensrealitäten: Die Kultur des Lebens und die damit verbundenen Herausforderungen verlangen nach einer kritischen Auseinandersetzung. Ich bin der Frage nachgegangen, wie das Streben nach Gleichheit und Akzeptanz inmitten von Missverständnissen und Vorurteilen von Bedeutung ist und wie es sich in der Literatur niederschlägt.
Zunächst ein paar Begriffsklärungen:
Die Ursprünge des Begriffs Wokeness und seine Bedeutung in Deutschland
Der Begriff Wokeness hat seine Wurzeln in der afroamerikanischen Kultur und entwickelte sich während der Bürgerrechtsbewegung in den USA in der Mitte des 20. Jahrhunderts im Kampf gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit Im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung seit 2013 und insbesondere nach dem Mord an George Floyd im Jahr 2020 rückt der Begriff wieder stärker ins öffentliche Blickfeld, auch in Deutschland. In der letzten Zeit findet er vor allem in den sozialen Medien wie häufig Verwendung, beispielsweise unter den Hashtags #woke und #staywoke. Von der eigentlichen Bedeutung „aufgeweckt, aufgewacht“ ist „woke“ in seiner aktuellen Verwendung längst entfernt. Vielmehr ist daraus ein umkämpftes Schlagwort geworden: auf der einen Seite als positive Selbstbezeichnung, auf der anderen Seite als abwertende Fremdbezeichnung. Heute ist er ein Sammelbegriff, der auch die queere Community umfasst, die sich für Vielfalt und Gleichberechtigung einsetzt. Wokeness polarisiert die Gesellschaft, und das nicht ohne Grund. Es gibt Befürworter und Gegner, wie die folgende Aufzählung darstellen soll:
Für Befürworter*innen des Begriffs bedeutet «Wokeness« oder «woke« zu sein, eine erhöhte Wachsamkeit für Themen wie Rassismus, Sexismus und andere Diskriminierungen zu beweisen. Gegner*nnen des Begriffs sehen in der Wokeness-Bewegung militante Gutmenschen, die der Mehrheitsgesellschaft Verhaltens- und Sprachregeln einer Minderheit vorschreiben wollen. Übergeordnet sehen sich woke Menschen dementsprechend als eine progressive Gruppe, die sich der prekären Zustände in der Welt bewusst ist und diese zum Besseren verändern will.
Wokeness ist für Gegner ein Mittel zur Selbstdarstellung von moralischer Überlegenheit, meist anonym ausgedrückt in sozialen Medien.
Als woke gilt beispielsweise, wer sich gegen die strukturell bedingte Benachteiligung von gesellschaftlichen Minderheiten erhebt oder sich durch das eigene Verhalten beispielsweise gegen den Klimawandel einsetzt.
In enger Verbindung zu Wokeness steht daher auch der Ausdruck „Cancel Culture“. Damit ist gemeint, mehr oder weniger bekannte Personen wegen (angeblichen oder tatsächlichen) diskriminierenden Verhaltens öffentlich zu ächten. Wer woke ist, befürwortet in der Regel auch die sogenannte Political Correctness. Das heißt: einen Sprachgebrauch, der niemanden diskriminiert. Umgekehrt gilt jemand nicht als woke, wenn die Person soziale Missstände nicht wahrnimmt (oder wahrhaben will) und diese stillschweigend akzeptiert, anstatt sich dagegen zur Wehr zu setzen.
Radikale Wokeness, die strikt in entweder ethisch richtiges oder falsches Handeln unterteilt und Fehlverhalten mit Ächtung bestraft, beinhaltet für Kritiker*innen einen Widerspruch in sich selbst. Dadurch führt Wokeness wiederum zu Ausgrenzung. Wokeness und Cancel Culture gelten somit als eine übermäßige Form von politische Korrektheit. Bereits politische Korrektheit lehnen Gegner*innen allerdings wegen vermeintlicher Beschränkung der Meinungsfreiheit und teilweise als Zensur ab.
Wokeness und die queere Community
Die Auseinandersetzung mit Wokeness ermöglicht es also, die unterschiedlichen Lebensrealitäten zu beleuchten und Raum für Dialog zu schaffen. Wie aber können wir als Autoren sicherstellen, dass das Leben queerer Menschen nicht zum Spielball eines missverstandenen Begriffs wird? Die Vielfalt innerhalb der LGBTQ+ -Gemeinschaft zeigt auf, wie wichtig es ist, sich gegen Diskriminierung und Vorurteile zu positionieren, denn der Begriff «woke« wird von kritischen Stimmen genutzt, um die Anliegen von lesbischen, schwulen, trans und inter- Personen zu delegitimieren oder zu stigmatisieren. «Woke« ist heute nicht nur ein Schlagwort, sondern wird regelrecht als Kampfbegriff – selbst in der queeren Community – missverstanden, was die Debatte über identitäre Themen zusätzlich anheizt. Warum? Nun, der Begriff „woke“ hat sich in der Community vom ursprünglich positiven Ausdruck für bewusstes Engagement gegen Ungerechtigkeiten zu einem Schimpfwort entwickelt, da er oft als übertriebene Rhetorik oder heuchlerisch wahrgenommen wird. Und viele Stimmen, die ich persönlich bei meiner Recherche gesprochen habe, empfinden, dass die Fokussierung auf „woke“ Themen von echten, tiefgreifenden sozialen Veränderungen ablenkt und in oberflächliche Diskussionen führt. Der Spannungsbogen liegt also zwischen aktivistischer Identitätspolitik und der Sorge um die tatsächliche Wirkkraft in der Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheit. Diese Gratwanderung spiegelt nicht nur eine Frage nach Identität wider, sondern sie ist auch ein Aufruf zur aktiven Teilnahme an gesellschaftlichen Veränderungen. Die Kultur der queeren Community ist stark geprägt durch den Wunsch nach Antidiskriminierung und Solidarität, was in vielen Beratungsangeboten sichtbar wird. Also sind eine differenzierte Beratung und Bildung unerlässlich, um ein besseres Verständnis für queere Lebensrealitäten zu fördern. Die Herausforderung liegt allerdings darin, die Sprache um den Begriff «woke« zu entschlüsseln und den ursprünglichen Sinn von Wokeness – das Streben nach Gleichheit und Solidarität – wiederherzustellen, denn Wokeness beschreibt letztlich den unermüdlichen Kampf für Gleichheit und Akzeptanz.
Wokeness in der Literatur:
Darf man eine Erzählung, in der Gewalt beschrieben wird, noch drucken? Geht ein Roman, in dem ein Reaktionär reaktionäres Zeug redet, in Ordnung? In Verlagen greift die Angst um sich, zum Gegenstand aggressiver Identitätsdebatten zu werden. Wokeness hat die Art und Weise, wie queere Lebensrealitäten in der Literatur dargestellt werden, grundlegend transformiert. In Deutschland, wo Vielfalt zunehmend gefeiert wird, sind Stimmen aus der queeren Community unverzichtbar geworden. Schwule, lesbische, trans- und inter-Menschen bringen authentische Perspektiven in Literatur ein, die das Leben in all seinen Facetten beleuchtet. Diese Kulturen des Schreibens fördern nicht nur das Verständnis, sondern auch eine tiefere Empathie für die Herausforderungen, mit denen viele heute konfrontiert sind. Inspirierende Werke, die nicht nur unterhalten, sondern auch aufklären und sensibilisieren, gibt es genug, wenn sie auch immer noch eine Nische bedienen. Autoren setzen sich vehement mit Themen auseinander, die oft ignoriert werden – sei es Diskriminierung oder der Kampf um Identität. Dabei wird deutlich: Wokeness ist kein bloßes Schlagwort, sondern ein Aufruf zur Reflexion und Veränderung innerhalb der Gesellschaft. So entsteht eine literarische Landschaft, die nicht nur Vielfalt abbildet, sondern sie auch aktiv fördert und weiterträgt.
Kritische Texte finden wir hier:
«Die Wokeness-Illusion – Wenn Political Correctness die Freiheit gefährdet““/Herder heißt ein jüngst erschienenes Buch der Cicero-Redaktion, in der sich die Autoren mit verschiedenen Aspekten der Identitätspolitik und der Wokeness beschäftigen.
Susan Neiman: «Links ist nicht woke«/Hanser 2023. Bei Susan Neiman, die sich ihr Leben lang vor allem mit der Aufklärung befasst hat, setzt sich fundiert, engagiert, mit gewichtigen Argumenten und in ruhigem Ton mit dem Thema auseinander.
Julie Burchill. «Willkommen bei den Woke-Tribunalen: Wie #Idenität fortschrittliche Politik zerstört (Critica Diabolis)«/TIAMAT 2023. Burchilles Abrechnung mit den „Woken“ ist eigentlich ein Genuss, wie immer ist sie scharfsinnig, witzig, zynisch und provokant, aber meist den wunden Punkt treffend.
Mein Fazit:
Die eingangs beschriebene Ambivalenz führt zu einer dringenden Diskussion darüber, ob Wokeness ein Werkzeug der Befreiung oder ein Instrument der Ausgrenzung ist – eine Frage, die uns alle betrifft! Die Herausforderung liegt darin, Wokeness als ein Werkzeug für positive Veränderungen zu nutzen und gleichzeitig die kritischen Stimmen ernst zu nehmen, die ihn als Kampfbegriff wahrnehmen oder als Schimpfwort benutzen. In der Kunst und Kultur haben wir es in der Hand, Sprache je nach Bedarf adäquat und zielgerichtet sachlich oder emotional zu nutzen. Achten wir also achtsam darauf, wie wir sie mit allen Farben einsetzen, damit wir uns selbst nicht zu ihrem Spielball machen, uns selbst dementieren und so Verantwortung als Schreibende tragen, die Welt ein bisschen besser zu machen – jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, und das für alle Menschen mit ihren Identitäten, überall auf der Welt.
In diesem Sinne. Bleib‘ wach, mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog: „Trans -Solidarischer Kampf innerhalb unserer Queerfamilie“

Tschüssi
Dein Samuel
Aktuell Politisches/Relevantes
12.09.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu aktuellen, gesellschaftlich/politisch relevanten Themen, die mich derzeit und immer wieder bewegen.
Heute:
Queer recherchiert: Rechtsdruck in Europa: Die Uhr tickt!
Was tun als queere Community?
Kunst kann sowohl persönliche als auch kollektive Geschichten erzählen und soziale, politische oder kulturelle Themen ansprechen. Oft dient sie als Spiegel der Gesellschaft, in dem sie sowohl die Schönheiten als auch die Herausforderungen des Lebens reflektiert. Darüber hinaus spielen Kunst und kulturelles Schaffen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Gemeinschaft und Identität, sie verbinden Menschen über kulturelle und soziale Grenzen hinweg und fördern das Verständnis füreinander. In einer Welt, die oft von Konflikten und Missverständnissen geprägt ist, kann Kunst als Brücke dienen, die Dialog und Empathie fördert.
Wenn aber die Welt um uns herum – so wie es gerade jetzt deutlich spürbar wird – in Bewegung ist und rechtsextreme und populistische Strömungen Kunst, Kultur und die Vielfalt der Gesellschaft ernsthaft bedrohen, dürfen wir nicht stillstehen! Der besorgniserregende Rechtsdruck in Europa stellt die queere Community vor immense Herausforderungen, und es ist an der Zeit, unsere Stimmen zu erheben! Gleichgültigkeit treibt Risse in die Pluralität der Nationen und ist überall dort menschenverachtend, wo an den Grundrechten eines jeden Menschen gerüttelt wird, dort ist Toleranz fehl am Platz! Betrachte ich die jüngsten Wahlergebnisse der bereits erfolgten Landeswahlen in Thüringen und Sachsen, geschweige der zu erwartenden in Brandenburg, wird mir regelrecht angst und bange!
Bastian Finke vom Mann-o-Meter e. V. Berlin leitet MANEO, das bekannteste schwule Anti-Gewalt-Projekt in Deutschland, das u.a. von der Bundeszentrale für politische Bildung mehrfach ausgezeichnet und gewürdigt wurde. Er bestätigt in einem kürzlich erfolgten Interview in der ARD, dass laut Studienergebnissen 38% aller Befragten nachhaltig unter psychischen Problemen und 22 % unter Rückzug und Vereinsamung leiden, geschürt durch Gewaltübergriffe und Ängste vor rechtsradikalen Angriffen. Der Ton gegen queere Menschen – gleich welcher Nation und Religion – werde immer stärker, ein Bekenntnis für Vielfalt und den Schutz queerer Menschen mit Verweis auf Artikel 3 GG sei zu einzufordern.
In vielen osteuropäischen Ländern sehen sich LGBTQ+ -Gemeinschaften drakonischen Gesetzen gegenüber, die ihre Identität und ihren Ausdruck einschränken, der Rechtsdruck auf queere Menschen in Europa beeinflusst auch Migration auf vielfältige Weise, und die Rechtslage zum Schutz von queeren Migrant*innen unterscheidet sich stark. In Polen und Ungarn beispielsweise zeigen sich verstärkt antiqueeristische Tendenzen, die durch gesetzliche Maßnahmen und politische Rhetorik legitimiert werden. Solche Maßnahmen führen nicht nur zur gesellschaftlichen Diskriminierung, sondern auch zur Einschüchterung und Verfolgung queerer Personen. In einigen Staaten sind die Asylverfahren nicht auf die spezifischen Bedürfnisse queerer Personen eingestellt, was die Migration erschwert. Beispielsweise können queere Menschen in Ländern, die keine ausreichenden Schutzmaßnahmen bieten oder in denen Verfolgung nicht anerkannt wird, in ihrer Freiheit stark eingeschränkt bleiben. Im Gegensatz dazu suchen viele queere Migrant*nnen gezielt Länder auf, die ihren Anforderungen nach Schutz und Gleichstellung besser gerecht werden, wie etwa Deutschland oder die Niederlande. Aber sind tatsächlich queere Menschen und solche eines nicht-christlichen Glaubens in Deutschland noch sicher, oder packen sie bereits gedanklich die Koffer? Und wenn ja, was können wir dagegen tun? Beleuchten wir zunächst einmal die Narrative der aktuell politischen Landschaft Deutschlands:
Rhetorik der Ausgrenzung: Eine der zentralen Taktiken von Parteien, die nicht in der Mitte angesiedelt sind, besteht darin, Minderheitengruppen durch eine teils subtile Sprache der Ausgrenzung und Dehumanisierung zu kennzeichnen. Es ist von «Remigration« statt Integration die Rede. Häufig werden Ängste in der Bevölkerung geschürt, indem eine vermeintliche Bedrohung durch «Fremde« oder «Nicht-Assimilierte« betont wird. Ich persönlich kenne Menschen, die als eindeutige Folteropfer und Verfolgte verzweifelt eine deutsche Staatsbürgerschaft anstreben, nur um nicht in ihre vermeintlich sichere Herkunftsländer ausgewiesen zu werden und jüdische Menschen, die sich nicht trauen, sich mit ihrem Glauben und/oder ihrer Queerness zu outen. Solche Zustände schaffen ein Klima, in dem Vorurteile gedeihen können und führen zu einer Abwertung der multinationalen Identität als Teil der gesellschaftlichen Pluralität. In der Rhetorik genannter Parteien wird impliziert, dass beispielsweise jüdisches Leben nur dann akzeptiert wird, wenn es den Normen und Erwartungen der Mehrheit entspricht, was eine direkte Bedrohung für die Vielfalt und das Recht auf Identität darstellt.
Ablehnung von interkulturellem Dialog: Partien, die sich gegen interkulturelle und interreligiöse Dialoge aussprechen, schaffen ein feindliches Umfeld, in dem es schwerfällt, Brücken zu bauen. Ein solches politische Stimmungsmache begünstigt das Entstehen von Misstrauen und Feindseligkeit, was direkte Auswirkungen auf das jüdische Leben hat, es verhindert eine tatsächliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus sowie dem Verständnis für andere Diskriminierungsformen.
Nationalistische Ideologie: Die Förderung eines starken nationalistischen Narrative, das die eigene Ethnie als überlegen oder als das wahre «Volk« darstellt, ist ein prominentes Merkmal der extemen politischen Gruppen. Diese Ideologie stellt eine Bedrohung für Menschen dar, die nicht zur als «deutsch« definierten Identität gehören – einschließlich Juden, die während der Geschichte nicht nur als «Nicht-Deutsche« betrachtet wurden, sondern auch als eine Gruppe, die man von der «reinen« Volksgemeinschaft ausschließen will. Diese Entwicklungen manifestieren sich in einer verstärkten Stigmatisierung von Minderheitengruppen, einschließlich der LGBTQ+ -Gemeinschaft. Mit dem Aufstieg nationalkonservativer und dem populistischen Narrativ sogenannter alternativer Parteien und dem Rückgang von sozialen Fortschritten wird ein Klima geschaffen, in dem Vorurteile und Diskriminierung regelrecht propagiert und wieder gesellschaftlich akzeptiert werden. Das jüdische Leben in Deutschland ist von einer tiefen historischen Prägung und einem beständigen Kampf um Akzeptanz und Gleichberechtigung gekennzeichnet. Angesichts des zunehmenden Rechtsdrucks ist die jüdische Gemeinschaft aktuell jedoch nachvollziehbar besorgt über die Rhetorik und Handlungen, die besonders von rechtsextremen Gruppierungen ausgehen. Antisemitismus nimmt neue Formen an, oft in Verbindung mit anderen Formen der Diskriminierung. Die Verbindung zwischen Antisemitismus und homophoben Strömungen ist besonders alarmierend, da sie ein doppeltes Stigma schaffen, das die Identität und Sicherheit vieler Menschen gefährdet.
Verharmlosung von Antisemitismus: Anstatt aktiv gegen Antisemitismus zu kämpfen und davon betroffene Gemeinschaften zu unterstützen, wird oft eine Haltung eingenommen, die besagt, dass antisemitische Äußerungen nur «Einzelfälle« seien oder dass die Sorgen um Antisemitismus übertrieben seien. Diese Rhetorik fördert nicht nur ein Gefühl der Unsicherheit unter jüdischen Menschen, sondern trägt auch dazu bei, dass antisemitische Verhaltensweisen gesellschaftlich weiterhin Toleranz finden.
Was also tun dagegen? Ich sehe zwei wesentliche Strategien für die queere Community:
Engagement in Initiativen zeigen: Es ist unerlässlich, dass die Mitglieder der Gesellschaft, insbesondere während Wahlzeiten, aufmerksam sind und die Auswirkungen dieser politischen Strömungen auf Minderheiten, einschließlich der jüdischen Bevölkerung, kritisch hinterfragen. Nur so kann ein Raum geschaffen werden, der von Repekt, Vielfalt und echtem Verständnis geprägt ist. Mut machen Initiativen, wie die das landesübergreifende «Bündnis für Mut und Verständigung«, wo neben anderen Institutionen die Friedenskirche Charlottenburg am 05. September 2024 wegen ihres langjährigen, besonderen Engagements für das interkulturelle Leben, Toleranz sowie gegen Rassismus eine Würdigung vom Berliner Staatssekretär Dr. B. Grimm und Brandenburgs Integrationsbeauftragten D. Gonzales Olivio erhält. Oder auch das «Any Way« in Köln, das via Social Medias über Vorurteile gegnüber LGBTQ+ aufklärt und einen Safe Space bietet, mit der erklärten Inspiration, «sich selbst zu sein«. (siehe Dokuserie «Queer Life infiltered«, ZDF vom 06.09.2024 ).
Kunst und Bildung als Ausdruck von Widerstand und Solidarität bietet eine weitere, entscheidende Rolle. Die Kraft der Kunst immer mehr zu einem wichtigen Werkzeug, um die queere Community zu stärken, sie ist in ihrem vielfältigen und multikulturellen Ausdruck ein kraftvolles bildungsförderndes Mittel, um Widerstand zu leisten und Solidarität zu zeigen. Aktuelle Kunstschaffende diverser Ausrichtungen eröffnen Räume für queere Stimmen und Geschichten, die oft im Schatten der Gesellschaft stehen. Künstler*innen nutzen ihre Kreativität, um Gemälde, Installationen, Literatur, Musik u.a. zu schaffen, die sowohl provozieren als auch zum Nachdenken anregen und auch einen Raum für den Austausch und die Sichtbarkeit einer persönlichen identität eröffnen. Ihre Werke erzählen Geschichten von Mut und Resilienz, sie sind Ausdruck von Widerstand gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit. In einer Zeit, in der jede Stimme zählt, bleibt die Kunst ein Werkzeug für Veränderung. Sie vereint Menschen über Ländergrenzen hinweg und stärkt den Glauben an eine bunte, inklusivere Zukunft. Es ist unerlässlich, dass wir Kunstschaffende mit ihren Projekten unterstützen, um sicherzustellen, dass die kreativen Ausdrucksformen nicht verstummen. Im Haus der Künste, Frankfurt/Oder, habe ich mir beeindruckende Gemälde und Installationen angeschaut, die die Kämpfe und Triumphe der queeren Community verkörpern, denn sie sind nicht nur ein Spiegel unserer aktuellen Realität, sondern auch eine Quelle der Hoffnung für zukünftige Generationen.
Mein Fazit
Die aktuellen politischen Entwicklungen, insbesondere im Kontext der bevorstehenden Wahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern, machen die Dringlichkeit des Themas Rechtsdruck umso klarer. Populistische und rechtsextreme Parteien versuchen, gesellschaftliche Spannungen auszunutzen und zu verstärken, was die Notwendigkeit für queere und jüdische Stimmen erhöht, um gegen diese Tendenzen zu protestieren.
Wähler*innen sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit der Wahl solcher Parteien einhergehen – sowohl für das jüdische Leben als auch für die LGBTQ+ -Gemeinschaft. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Stimmen in der politischen Debatte Gehör finden und dass alle, die für eine inklusive und gerechte Gesellschaft eintreten, zusammenarbeiten, um für ihre Rechte und ihre Sichtbarkeit zu kämpfen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt – für mehr Solidarität und gegen Diskriminierung in all ihren Formen. Ich halte es für unerlässlich, in der Sichtbarkeit zu bleiben.
Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer zeigt sich in einem Interview vom 20.06. 2024 mit der Vogue über die aktuelle politische Situation entsetzt, da sie sie an ihr zwölftes Lebensjahr erinnere, wo Hitler an die Macht kam und appelliert deshalb unermüdlich mit Nachdruck:
«Schaut nicht auf das, was euch trennt. Schaut auf das, was euch verbindet. Seid Menschen. Seid vernünftig.“
In diesem Sinne. Bleib‘ wach, mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog: „Wokeness – wie ein Kampfbegriff zum (auch queeren) Schimpfwort wurde“

Tschüssi
Dein Samuel
Aktuell Politisches/Relevantes
15.08.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu aktuellen, gesellschaftlich/politisch relevanten Themen, die mich derzeit und immer wieder bewegen.
Heute:
Queer gedacht: Biologische Familie und Wahlfamilie- Wenn Wunschträume auf Realitäten treffen
Liebe queere Community,
Der Mensch hat ein angeborenes Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Das tradierte, stereotype Konzept Familie gilt dabei als eine der grundlegendsten sozialen Institutionen, die in allen Kulturen und Nationalitäten der Welt eine vielschichtige und zentrale Rolle spielt. Sie ist nicht nur ein Ort der emotionalen und versorgungstechnischen Unterstützung, sondern auch ein entscheidender Faktor für die soziale Stabilität und den kulturellen Austausch. Im Kern erfüllt die Familie mehrere wichtige Funktionen. In erster Linie ist sie ein Bindeglied zwischen Individuum und Gesellschaft. Durch Erziehung und Sozialisation vermittelt die Familie Werte, Normen und Verhaltensmuster, die in der jeweiligen Kultur verankert sind. Kinder lernen innerhalb der Familie, was richtig und falsch ist, und entwickeln ein Gefühl für Identität und Zugehörigkeit.
Darüber hinaus fungiert die Familie als wirtschaftliche Einheit. In vielen Kulturen, insbesondere in traditionellen Gesellschaften, spielt die Familie eine zentrale Rolle in der Produktion und Verteilung von Ressourcen. Diese gemeinschaftlichen Aspekte fördern nicht nur den Zusammenhalt, sondern auch das Überleben und die Fortpflanzung kultureller Praktiken. Obwohl die Grundfunktionen der Familie in allen Kulturen ähnlich sind, variieren ihre Formen und Strukturen erheblich. In westlichen Gesellschaften dominiert häufig die Kernfamilie, bestehend aus Eltern und Kindern. Diese Form betont Individualismus und Unabhängigkeit. In vielen asiatischen Kulturen hingegen hat die erweiterte Familie, die Großeltern, Onkel, Tanten und Cousins einschließt, eine bedeutendere Rolle. Hier ist die kollektive Verantwortung und die Ehre der Familie zentral, was oft zu einem stärkeren sozialen Zusammenhalt führt. Ein weiteres Beispiel sind matrilineare Gesellschaften, wie einige indigene Gruppen in Nordamerika oder Teilen Indiens. Hier vererbt sich der Besitz und das soziale Ansehen durch die weibliche Linie, was die Rolle der Frauen in diesen Gemeinschaften stärkt und oft zu einer stärkeren sozialen Solidarität unter den Frauen führt. Die Funktionen der Familie sind also nicht nur auf die Wirtschaft und Sozialisation beschränkt. Sie sind auch entscheidend für emotionale Unterstützung und psychisches Wohlbefinden. In vielen Kulturen ist die Familie der Rückhalt in Krisensituationen; sie bietet gemeinschaftliche Ressourcen, die in Zeiten der Not unerlässlich sind. Dennoch zeigen sich auch interkulturelle Unterschiede in der Art und Weise, wie diese Unterstützung angeboten wird, insbesondere für LGBTQI+- Personen. In kollektivistisch geprägten Kulturen wird häufig mehr Wert auf gemeinschaftliches Wohlergehen gelegt, während individualistische Kulturen tendenziell persönliche Freiräume und emotionale Unabhängigkeit priorisieren.
Was aber, wenn neben der biologischen Herkunftsfamilie einer LGBTQ+- Person eine selbstgewählte weitere Familie hinzukommt und dadurch Konflikte entstehen? Besonders queere Personen nämlich stehen oft vor Heraus-forderungen innerhalb ihrer Kernfamilie, denn diese kann auch Quelle von Ablehnung, Misstrauen und Unverständnis hinsichtlich ihres Outings oder ihres nicht gesellschaftskonformen Lebensstils sein. Dies führt dazu, dass sie sich für eine alternative Familienstruktur, eine Familie ihrer Wahl entscheiden, die auf gegenseitigem Respekt, Unterstützung und bedingungsloser Liebe basiert – die sie ansonsten schmerzlich vermissen. Eine solche Wahlfamilie, bestehend aus beispielsweise engen Vertrauten, Partner*innen, Wegbegleiter*innen oder einer Wohn- oder Lebensgemeinschaft, ermöglicht es ihnen, emotionalen Rückhalt und ein Gefühl von Zugehörigkeit «ohne Wenn und Aber« zu finden. Diese Form der Familie bietet ihnen die nötige Nestwärme, einen sicheren Hafen, in dem sie ihre wahre Identität und Individualität entfalten können, ohne Angst vor Diskriminierung oder Ablehnung haben zu müssen.
Wir sehen: Die Verbindung zwischen biologischer Familie und Wahlfamilie ist also oft komplex.
Dies macht es umso wichtiger, dass queere Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft– die Möglichkeit haben, sich alternative, rechtssichere Familienstrukturen aufzubauen, die auf Liebe und Akzeptanz basieren. Das wiederum kann je nach kulturellem Hintergrund besonders schwierig sein. Und was, wenn die sogenannte Wahlfamilie auf gesellschaftliche, kulturelle und rechtliche Widerstände stößt? In der Realität stoßen queere Menschen auch auf vielerlei gesellschaftliche und rechtliche Hürden in Bezug auf ihre Familienkonstellationen: Viele Länder/Nationen und Religionen erkennen queere Familienstrukturen nicht an, was nicht nur zu rechtlichen Ungleichheiten und Schwierigkeiten führen kann. Nicht zu vergessen: (Z): «In vielen Fällen schüren religiöse und politische Führer ein Klima des Hasses. LSBTI sollen eingeschüchtert und in die Unsichtbarkeit gedrängt werden. Verfolgung und Ausgrenzung, oft auch durch die eigene Familie, führt häufig zu bitterer Armut und einem Leben am Rand der Gesellschaft. LSBTIQ+ -feindliche Gewalt (auch innerhalb der Familien) bleibt vielerorts ohne Konsequenzen für die Täter.« (Siehe https://www.lsvd.de/de/ct/1245-LGBT-Rechte-weltweit.) Folglich sind queere Menschen oft mit zusätzlichen Belastungen, Unsicherheiten oder sogar Gefahren konfrontiert, wenn es um ihre Familie geht.
Eines der zentralen Probleme ist erstens die Anerkennung von Elternschaft in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, Rechte und Pflichten von LGBT+ -Eltern sind nicht ausreichend gesetzlich verankert, was zu rechtlichen Grauzonen führt. Im Hinblick auf die Adoption von Kindern können queere Paare in einigen Regionen mit restriktiven Gesetzen und Diskriminierung konfrontiert sein. Die Möglichkeit, als gleichgeschlechtliches Paar ein Kind zu adoptieren, kann stark eingeschränkt oder sogar verboten sein, was zu Ungleichheiten und Hindernissen bei der Bildung einer Familie führt. Ein weiteres rechtliches Problem betrifft das Sorgerecht für Kinder in non-normativen Strukturen. Die rechtliche Anerkennung von Co-Elternschaft oder Aufbau von rechtlichen Bindungen zwischen nicht-biologischen Eltern und Kindern sind vielfach uneinheitlich und kompliziert. In Fällen von Trennung oder Scheidung kann es vorkommen, dass nicht-biologische Elternteile Schwierigkeiten haben, ihr Sorgerecht oder gar Besuchsrecht zu erhalten.
Des Weiteren können queere Familien mit Herausforderungen im Bereich des Erbrechts konfrontiert sein. Die mangelnde rechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und nicht-biologischen Eltern kann dazu führen, dass queere Familienmitglieder benachteiligt werden, wenn es um die Verteilung von Erbschaften und finanziellen Angelegenheiten geht. Ich begegne immer wieder queeren Menschen, die – wie oben beschrieben – in regenbogenfamiliären Strukturen vor einer komplexen rechtlichen Landschaft stehen, die geprägt ist von Diskriminierung, Ungleichheiten und fehlender Anerkennung. Die Bewältigung dieser rechtlichen Herausforderungen schreit nach einer umfassenden Reform und Gleichstellungspolitik, die darauf abzielt, die Rechte und Pflichten von LGBT+ -Eltern und Familien in vollem Umfang anzuerkennen und zu schützen; nur durch eine inklusive und gerechte Rechtsprechung können regenbogenfamiliäre Strukturen die gleichen rechtlichen Sicherheiten und Schutzmaßnahmen erhalten wie heterosexuelle Familien.
Mein Fazit
Nur indem Politik und Gesellschaft die Vielfalt und Einzigartigkeit queerer Familien anerkennen und unterstützen, können sie dazu beitragen, eine inklusivere und gerechtere Gesellschaft zu schaffen, in der alle Menschen das Recht haben, geliebt, akzeptiert und respektiert zu werden – unabhhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Insgesamt verdeutlicht die Bedeutung von biologischer Familie und Wahlfamilie für die queere Community, wie wichtig es ist, Raum für unterschiedliche Familienformen und -strukturen zu schaffen.
Die Familie bleibt eine fundamentale soziale Institution, die weltweit relevante Funktionen erfüllt. Ihre Struktur und Bedeutung variieren jedoch je nach kulturellem Kontext. Während in einigen Kulturen die Kernfamilie im Vordergrund steht, sind in anderen erweiterte Familienstrukturen entscheidend. Die interkulturelle Vielfalt der Familienformen spiegelt nicht nur unterschiedliche soziale und wirtschaftliche Realitäten wider, sondern bietet auch spannende Einblicke in menschliches Miteinander und die Formung von Identitäten. Meine Recherchen und Umfragen in den Sozialen Medien ergaben, dass es viele positive Besipiele gibt, in denen verschiedene Familienmodelle miteinander erfolgreich kooperieren und sich ergänzen. Doch die Herausforderung im globalen Kontext besteht einerseits darin, die jeweilige Familienkultur wertzuschätzen und zugleich den gemeinsamen ganzheitlichen Menschlichkeitssinn zu fördern, um ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen. Andererseits und besonders zu betonen ist, dass für die LGBTQ+ -Community Raum für unterschiedliche Familienformen und -strukturen zu schaffen ist, oben erwähnte Nachteile im Rechtsraum aufgelöst und dafür eine Rechtssicherheit von der Regierung verankert werden muss.
Liebe Biologische Familien: Eine Wahl- oder Wunschfamilie eurer Liebsten sollte weder als Konkurrenz verstanden noch ein Wunschtraum bleiben, da sie keine Gefahr für niemanden darstellt und im Idealfall eine Bereicherung für beide Seiten sein kann! Ich halte es für bemerkenswert, dass die queere Community Widerstandskraft und Kreativität zeigt, wenn es darum geht, ihre eigenen neuen Familien zu gestalten und zu stärken bzw. mit der Herkunftsfamilie zu verbinden. Nur durch den Aufbau von solidarischen Netzwerken und Unterstützungssystemen gelingt es, ein Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft zu schaffen, das über biologische Verwandtschaft hinausgeht. Wahlfamilien könnten durch das Institut der Verantwortungsgemeinschaft eine Möglichkeit erhalten, für einander alltagspraktisch, aber auch in Extremlagen wie im Pflege- oder Todesfall, rechtliche Verantwortung zu übernehmen. Was also spricht gegen sie? Also: Fahne hoch für die Wahlfamilien!
Und Hier ein paar hilfreiche Links zum Thema:
https://www.queer-rainbow-family.lgbt/ueber-uns/
https://www.tbb-berlin.de/category/meine-familie (für die türkische Community)
Bleib‘ mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog: „Rechtsdruck in Westeuropa nach der EU-Wahl- Auswirkungen und Konsequenzen für die LGBTQ+ -Community“

Tschüssi
Dein Samuel
Aktuell Politisches/Relevantes
12.09.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu aktuellen, gesellschaftlich/politisch relevanten Themen, die mich derzeit und immer wieder bewegen.
Heute:
Queer recherchiert: Rechtsdruck in Europa: Die Uhr tickt!
Was tun als queere Community?
Kunst kann sowohl persönliche als auch kollektive Geschichten erzählen und soziale, politische oder kulturelle Themen ansprechen. Oft dient sie als Spiegel der Gesellschaft, in dem sie sowohl die Schönheiten als auch die Herausforderungen des Lebens reflektiert. Darüber hinaus spielen Kunst und kulturelles Schaffen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Gemeinschaft und Identität, sie verbinden Menschen über kulturelle und soziale Grenzen hinweg und fördern das Verständnis füreinander. In einer Welt, die oft von Konflikten und Missverständnissen geprägt ist, kann Kunst als Brücke dienen, die Dialog und Empathie fördert.
Wenn aber die Welt um uns herum – so wie es gerade jetzt deutlich spürbar wird – in Bewegung ist und rechtsextreme und populistische Strömungen Kunst, Kultur und die Vielfalt der Gesellschaft ernsthaft bedrohen, dürfen wir nicht stillstehen! Der besorgniserregende Rechtsdruck in Europa stellt die queere Community vor immense Herausforderungen, und es ist an der Zeit, unsere Stimmen zu erheben! Gleichgültigkeit treibt Risse in die Pluralität der Nationen und ist überall dort menschenverachtend, wo an den Grundrechten eines jeden Menschen gerüttelt wird, dort ist Toleranz fehl am Platz! Betrachte ich die jüngsten Wahlergebnisse der bereits erfolgten Landeswahlen in Thüringen und Sachsen, geschweige der zu erwartenden in Brandenburg, wird mir regelrecht angst und bange!
Bastian Finke vom Mann-o-Meter e. V. Berlin leitet MANEO, das bekannteste schwule Anti-Gewalt-Projekt in Deutschland, das u.a. von der Bundeszentrale für politische Bildung mehrfach ausgezeichnet und gewürdigt wurde. Er bestätigt in einem kürzlich erfolgten Interview in der ARD, dass laut Studienergebnissen 38% aller Befragten nachhaltig unter psychischen Problemen und 22 % unter Rückzug und Vereinsamung leiden, geschürt durch Gewaltübergriffe und Ängste vor rechtsradikalen Angriffen. Der Ton gegen queere Menschen – gleich welcher Nation und Religion – werde immer stärker, ein Bekenntnis für Vielfalt und den Schutz queerer Menschen mit Verweis auf Artikel 3 GG sei zu einzufordern.
In vielen osteuropäischen Ländern sehen sich LGBTQ+ -Gemeinschaften drakonischen Gesetzen gegenüber, die ihre Identität und ihren Ausdruck einschränken, der Rechtsdruck auf queere Menschen in Europa beeinflusst auch Migration auf vielfältige Weise, und die Rechtslage zum Schutz von queeren Migrant*innen unterscheidet sich stark. In Polen und Ungarn beispielsweise zeigen sich verstärkt antiqueeristische Tendenzen, die durch gesetzliche Maßnahmen und politische Rhetorik legitimiert werden. Solche Maßnahmen führen nicht nur zur gesellschaftlichen Diskriminierung, sondern auch zur Einschüchterung und Verfolgung queerer Personen. In einigen Staaten sind die Asylverfahren nicht auf die spezifischen Bedürfnisse queerer Personen eingestellt, was die Migration erschwert. Beispielsweise können queere Menschen in Ländern, die keine ausreichenden Schutzmaßnahmen bieten oder in denen Verfolgung nicht anerkannt wird, in ihrer Freiheit stark eingeschränkt bleiben. Im Gegensatz dazu suchen viele queere Migrant*nnen gezielt Länder auf, die ihren Anforderungen nach Schutz und Gleichstellung besser gerecht werden, wie etwa Deutschland oder die Niederlande. Aber sind tatsächlich queere Menschen und solche eines nicht-christlichen Glaubens in Deutschland noch sicher, oder packen sie bereits gedanklich die Koffer? Und wenn ja, was können wir dagegen tun? Beleuchten wir zunächst einmal die Narrative der aktuell politischen Landschaft Deutschlands:
Rhetorik der Ausgrenzung: Eine der zentralen Taktiken von Parteien, die nicht in der Mitte angesiedelt sind, besteht darin, Minderheitengruppen durch eine teils subtile Sprache der Ausgrenzung und Dehumanisierung zu kennzeichnen. Es ist von «Remigration« statt Integration die Rede. Häufig werden Ängste in der Bevölkerung geschürt, indem eine vermeintliche Bedrohung durch «Fremde« oder «Nicht-Assimilierte« betont wird. Ich persönlich kenne Menschen, die als eindeutige Folteropfer und Verfolgte verzweifelt eine deutsche Staatsbürgerschaft anstreben, nur um nicht in ihre vermeintlich sichere Herkunftsländer ausgewiesen zu werden und jüdische Menschen, die sich nicht trauen, sich mit ihrem Glauben und/oder ihrer Queerness zu outen. Solche Zustände schaffen ein Klima, in dem Vorurteile gedeihen können und führen zu einer Abwertung der multinationalen Identität als Teil der gesellschaftlichen Pluralität. In der Rhetorik genannter Parteien wird impliziert, dass beispielsweise jüdisches Leben nur dann akzeptiert wird, wenn es den Normen und Erwartungen der Mehrheit entspricht, was eine direkte Bedrohung für die Vielfalt und das Recht auf Identität darstellt.
Ablehnung von interkulturellem Dialog: Partien, die sich gegen interkulturelle und interreligiöse Dialoge aussprechen, schaffen ein feindliches Umfeld, in dem es schwerfällt, Brücken zu bauen. Ein solches politische Stimmungsmache begünstigt das Entstehen von Misstrauen und Feindseligkeit, was direkte Auswirkungen auf das jüdische Leben hat, es verhindert eine tatsächliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus sowie dem Verständnis für andere Diskriminierungsformen.
Nationalistische Ideologie: Die Förderung eines starken nationalistischen Narrative, das die eigene Ethnie als überlegen oder als das wahre «Volk« darstellt, ist ein prominentes Merkmal der extemen politischen Gruppen. Diese Ideologie stellt eine Bedrohung für Menschen dar, die nicht zur als «deutsch« definierten Identität gehören – einschließlich Juden, die während der Geschichte nicht nur als «Nicht-Deutsche« betrachtet wurden, sondern auch als eine Gruppe, die man von der «reinen« Volksgemeinschaft ausschließen will. Diese Entwicklungen manifestieren sich in einer verstärkten Stigmatisierung von Minderheitengruppen, einschließlich der LGBTQ+ -Gemeinschaft. Mit dem Aufstieg nationalkonservativer und dem populistischen Narrativ sogenannter alternativer Parteien und dem Rückgang von sozialen Fortschritten wird ein Klima geschaffen, in dem Vorurteile und Diskriminierung regelrecht propagiert und wieder gesellschaftlich akzeptiert werden. Das jüdische Leben in Deutschland ist von einer tiefen historischen Prägung und einem beständigen Kampf um Akzeptanz und Gleichberechtigung gekennzeichnet. Angesichts des zunehmenden Rechtsdrucks ist die jüdische Gemeinschaft aktuell jedoch nachvollziehbar besorgt über die Rhetorik und Handlungen, die besonders von rechtsextremen Gruppierungen ausgehen. Antisemitismus nimmt neue Formen an, oft in Verbindung mit anderen Formen der Diskriminierung. Die Verbindung zwischen Antisemitismus und homophoben Strömungen ist besonders alarmierend, da sie ein doppeltes Stigma schaffen, das die Identität und Sicherheit vieler Menschen gefährdet.
Verharmlosung von Antisemitismus: Anstatt aktiv gegen Antisemitismus zu kämpfen und davon betroffene Gemeinschaften zu unterstützen, wird oft eine Haltung eingenommen, die besagt, dass antisemitische Äußerungen nur «Einzelfälle« seien oder dass die Sorgen um Antisemitismus übertrieben seien. Diese Rhetorik fördert nicht nur ein Gefühl der Unsicherheit unter jüdischen Menschen, sondern trägt auch dazu bei, dass antisemitische Verhaltensweisen gesellschaftlich weiterhin Toleranz finden.
Was also tun dagegen? Ich sehe zwei wesentliche Strategien für die queere Community:
Engagement in Initiativen zeigen: Es ist unerlässlich, dass die Mitglieder der Gesellschaft, insbesondere während Wahlzeiten, aufmerksam sind und die Auswirkungen dieser politischen Strömungen auf Minderheiten, einschließlich der jüdischen Bevölkerung, kritisch hinterfragen. Nur so kann ein Raum geschaffen werden, der von Repekt, Vielfalt und echtem Verständnis geprägt ist. Mut machen Initiativen, wie die das landesübergreifende «Bündnis für Mut und Verständigung«, wo neben anderen Institutionen die Friedenskirche Charlottenburg am 05. September 2024 wegen ihres langjährigen, besonderen Engagements für das interkulturelle Leben, Toleranz sowie gegen Rassismus eine Würdigung vom Berliner Staatssekretär Dr. B. Grimm und Brandenburgs Integrationsbeauftragten D. Gonzales Olivio erhält. Oder auch das «Any Way« in Köln, das via Social Medias über Vorurteile gegnüber LGBTQ+ aufklärt und einen Safe Space bietet, mit der erklärten Inspiration, «sich selbst zu sein«. (siehe Dokuserie «Queer Life infiltered«, ZDF vom 06.09.2024 ).
Kunst und Bildung als Ausdruck von Widerstand und Solidarität bietet eine weitere, entscheidende Rolle. Die Kraft der Kunst immer mehr zu einem wichtigen Werkzeug, um die queere Community zu stärken, sie ist in ihrem vielfältigen und multikulturellen Ausdruck ein kraftvolles bildungsförderndes Mittel, um Widerstand zu leisten und Solidarität zu zeigen. Aktuelle Kunstschaffende diverser Ausrichtungen eröffnen Räume für queere Stimmen und Geschichten, die oft im Schatten der Gesellschaft stehen. Künstler*innen nutzen ihre Kreativität, um Gemälde, Installationen, Literatur, Musik u.a. zu schaffen, die sowohl provozieren als auch zum Nachdenken anregen und auch einen Raum für den Austausch und die Sichtbarkeit einer persönlichen identität eröffnen. Ihre Werke erzählen Geschichten von Mut und Resilienz, sie sind Ausdruck von Widerstand gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit. In einer Zeit, in der jede Stimme zählt, bleibt die Kunst ein Werkzeug für Veränderung. Sie vereint Menschen über Ländergrenzen hinweg und stärkt den Glauben an eine bunte, inklusivere Zukunft. Es ist unerlässlich, dass wir Kunstschaffende mit ihren Projekten unterstützen, um sicherzustellen, dass die kreativen Ausdrucksformen nicht verstummen. Im Haus der Künste, Frankfurt/Oder, habe ich mir beeindruckende Gemälde und Installationen angeschaut, die die Kämpfe und Triumphe der queeren Community verkörpern, denn sie sind nicht nur ein Spiegel unserer aktuellen Realität, sondern auch eine Quelle der Hoffnung für zukünftige Generationen.
Mein Fazit
Die aktuellen politischen Entwicklungen, insbesondere im Kontext der bevorstehenden Wahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern, machen die Dringlichkeit des Themas Rechtsdruck umso klarer. Populistische und rechtsextreme Parteien versuchen, gesellschaftliche Spannungen auszunutzen und zu verstärken, was die Notwendigkeit für queere und jüdische Stimmen erhöht, um gegen diese Tendenzen zu protestieren.
Wähler*innen sollten sich der Risiken bewusst sein, die mit der Wahl solcher Parteien einhergehen – sowohl für das jüdische Leben als auch für die LGBTQ+ -Gemeinschaft. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Stimmen in der politischen Debatte Gehör finden und dass alle, die für eine inklusive und gerechte Gesellschaft eintreten, zusammenarbeiten, um für ihre Rechte und ihre Sichtbarkeit zu kämpfen. Die Zeit zum Handeln ist jetzt – für mehr Solidarität und gegen Diskriminierung in all ihren Formen. Ich halte es für unerlässlich, in der Sichtbarkeit zu bleiben.
Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer zeigt sich in einem Interview vom 20.06. 2024 mit der Vogue über die aktuelle politische Situation entsetzt, da sie sie an ihr zwölftes Lebensjahr erinnere, wo Hitler an die Macht kam und appelliert deshalb unermüdlich mit Nachdruck:
«Schaut nicht auf das, was euch trennt. Schaut auf das, was euch verbindet. Seid Menschen. Seid vernünftig.“
In diesem Sinne. Bleib‘ wach, mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog: „Wokeness – wie ein Kampfbegriff zum (auch queeren) Schimpfwort wurde“

Tschüssi
Dein Samuel
Aktuell Politisches/Relevantes
15.08.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu aktuellen, gesellschaftlich/politisch relevanten Themen, die mich derzeit und immer wieder bewegen.
Heute:
Queer gedacht: Biologische Familie und Wahlfamilie- Wenn Wunschträume auf Realitäten treffen
Liebe queere Community,
Der Mensch hat ein angeborenes Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit. Das tradierte, stereotype Konzept Familie gilt dabei als eine der grundlegendsten sozialen Institutionen, die in allen Kulturen und Nationalitäten der Welt eine vielschichtige und zentrale Rolle spielt. Sie ist nicht nur ein Ort der emotionalen und versorgungstechnischen Unterstützung, sondern auch ein entscheidender Faktor für die soziale Stabilität und den kulturellen Austausch. Im Kern erfüllt die Familie mehrere wichtige Funktionen. In erster Linie ist sie ein Bindeglied zwischen Individuum und Gesellschaft. Durch Erziehung und Sozialisation vermittelt die Familie Werte, Normen und Verhaltensmuster, die in der jeweiligen Kultur verankert sind. Kinder lernen innerhalb der Familie, was richtig und falsch ist, und entwickeln ein Gefühl für Identität und Zugehörigkeit.
Darüber hinaus fungiert die Familie als wirtschaftliche Einheit. In vielen Kulturen, insbesondere in traditionellen Gesellschaften, spielt die Familie eine zentrale Rolle in der Produktion und Verteilung von Ressourcen. Diese gemeinschaftlichen Aspekte fördern nicht nur den Zusammenhalt, sondern auch das Überleben und die Fortpflanzung kultureller Praktiken. Obwohl die Grundfunktionen der Familie in allen Kulturen ähnlich sind, variieren ihre Formen und Strukturen erheblich. In westlichen Gesellschaften dominiert häufig die Kernfamilie, bestehend aus Eltern und Kindern. Diese Form betont Individualismus und Unabhängigkeit. In vielen asiatischen Kulturen hingegen hat die erweiterte Familie, die Großeltern, Onkel, Tanten und Cousins einschließt, eine bedeutendere Rolle. Hier ist die kollektive Verantwortung und die Ehre der Familie zentral, was oft zu einem stärkeren sozialen Zusammenhalt führt. Ein weiteres Beispiel sind matrilineare Gesellschaften, wie einige indigene Gruppen in Nordamerika oder Teilen Indiens. Hier vererbt sich der Besitz und das soziale Ansehen durch die weibliche Linie, was die Rolle der Frauen in diesen Gemeinschaften stärkt und oft zu einer stärkeren sozialen Solidarität unter den Frauen führt. Die Funktionen der Familie sind also nicht nur auf die Wirtschaft und Sozialisation beschränkt. Sie sind auch entscheidend für emotionale Unterstützung und psychisches Wohlbefinden. In vielen Kulturen ist die Familie der Rückhalt in Krisensituationen; sie bietet gemeinschaftliche Ressourcen, die in Zeiten der Not unerlässlich sind. Dennoch zeigen sich auch interkulturelle Unterschiede in der Art und Weise, wie diese Unterstützung angeboten wird, insbesondere für LGBTQI+- Personen. In kollektivistisch geprägten Kulturen wird häufig mehr Wert auf gemeinschaftliches Wohlergehen gelegt, während individualistische Kulturen tendenziell persönliche Freiräume und emotionale Unabhängigkeit priorisieren.
Was aber, wenn neben der biologischen Herkunftsfamilie einer LGBTQ+- Person eine selbstgewählte weitere Familie hinzukommt und dadurch Konflikte entstehen? Besonders queere Personen nämlich stehen oft vor Heraus-forderungen innerhalb ihrer Kernfamilie, denn diese kann auch Quelle von Ablehnung, Misstrauen und Unverständnis hinsichtlich ihres Outings oder ihres nicht gesellschaftskonformen Lebensstils sein. Dies führt dazu, dass sie sich für eine alternative Familienstruktur, eine Familie ihrer Wahl entscheiden, die auf gegenseitigem Respekt, Unterstützung und bedingungsloser Liebe basiert – die sie ansonsten schmerzlich vermissen. Eine solche Wahlfamilie, bestehend aus beispielsweise engen Vertrauten, Partner*innen, Wegbegleiter*innen oder einer Wohn- oder Lebensgemeinschaft, ermöglicht es ihnen, emotionalen Rückhalt und ein Gefühl von Zugehörigkeit «ohne Wenn und Aber« zu finden. Diese Form der Familie bietet ihnen die nötige Nestwärme, einen sicheren Hafen, in dem sie ihre wahre Identität und Individualität entfalten können, ohne Angst vor Diskriminierung oder Ablehnung haben zu müssen.
Wir sehen: Die Verbindung zwischen biologischer Familie und Wahlfamilie ist also oft komplex.
Dies macht es umso wichtiger, dass queere Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft– die Möglichkeit haben, sich alternative, rechtssichere Familienstrukturen aufzubauen, die auf Liebe und Akzeptanz basieren. Das wiederum kann je nach kulturellem Hintergrund besonders schwierig sein. Und was, wenn die sogenannte Wahlfamilie auf gesellschaftliche, kulturelle und rechtliche Widerstände stößt? In der Realität stoßen queere Menschen auch auf vielerlei gesellschaftliche und rechtliche Hürden in Bezug auf ihre Familienkonstellationen: Viele Länder/Nationen und Religionen erkennen queere Familienstrukturen nicht an, was nicht nur zu rechtlichen Ungleichheiten und Schwierigkeiten führen kann. Nicht zu vergessen: (Z): «In vielen Fällen schüren religiöse und politische Führer ein Klima des Hasses. LSBTI sollen eingeschüchtert und in die Unsichtbarkeit gedrängt werden. Verfolgung und Ausgrenzung, oft auch durch die eigene Familie, führt häufig zu bitterer Armut und einem Leben am Rand der Gesellschaft. LSBTIQ+ -feindliche Gewalt (auch innerhalb der Familien) bleibt vielerorts ohne Konsequenzen für die Täter.« (Siehe https://www.lsvd.de/de/ct/1245-LGBT-Rechte-weltweit.) Folglich sind queere Menschen oft mit zusätzlichen Belastungen, Unsicherheiten oder sogar Gefahren konfrontiert, wenn es um ihre Familie geht.
Eines der zentralen Probleme ist erstens die Anerkennung von Elternschaft in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, Rechte und Pflichten von LGBT+ -Eltern sind nicht ausreichend gesetzlich verankert, was zu rechtlichen Grauzonen führt. Im Hinblick auf die Adoption von Kindern können queere Paare in einigen Regionen mit restriktiven Gesetzen und Diskriminierung konfrontiert sein. Die Möglichkeit, als gleichgeschlechtliches Paar ein Kind zu adoptieren, kann stark eingeschränkt oder sogar verboten sein, was zu Ungleichheiten und Hindernissen bei der Bildung einer Familie führt. Ein weiteres rechtliches Problem betrifft das Sorgerecht für Kinder in non-normativen Strukturen. Die rechtliche Anerkennung von Co-Elternschaft oder Aufbau von rechtlichen Bindungen zwischen nicht-biologischen Eltern und Kindern sind vielfach uneinheitlich und kompliziert. In Fällen von Trennung oder Scheidung kann es vorkommen, dass nicht-biologische Elternteile Schwierigkeiten haben, ihr Sorgerecht oder gar Besuchsrecht zu erhalten.
Des Weiteren können queere Familien mit Herausforderungen im Bereich des Erbrechts konfrontiert sein. Die mangelnde rechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und nicht-biologischen Eltern kann dazu führen, dass queere Familienmitglieder benachteiligt werden, wenn es um die Verteilung von Erbschaften und finanziellen Angelegenheiten geht. Ich begegne immer wieder queeren Menschen, die – wie oben beschrieben – in regenbogenfamiliären Strukturen vor einer komplexen rechtlichen Landschaft stehen, die geprägt ist von Diskriminierung, Ungleichheiten und fehlender Anerkennung. Die Bewältigung dieser rechtlichen Herausforderungen schreit nach einer umfassenden Reform und Gleichstellungspolitik, die darauf abzielt, die Rechte und Pflichten von LGBT+ -Eltern und Familien in vollem Umfang anzuerkennen und zu schützen; nur durch eine inklusive und gerechte Rechtsprechung können regenbogenfamiliäre Strukturen die gleichen rechtlichen Sicherheiten und Schutzmaßnahmen erhalten wie heterosexuelle Familien.
Mein Fazit
Nur indem Politik und Gesellschaft die Vielfalt und Einzigartigkeit queerer Familien anerkennen und unterstützen, können sie dazu beitragen, eine inklusivere und gerechtere Gesellschaft zu schaffen, in der alle Menschen das Recht haben, geliebt, akzeptiert und respektiert zu werden – unabhhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Insgesamt verdeutlicht die Bedeutung von biologischer Familie und Wahlfamilie für die queere Community, wie wichtig es ist, Raum für unterschiedliche Familienformen und -strukturen zu schaffen.
Die Familie bleibt eine fundamentale soziale Institution, die weltweit relevante Funktionen erfüllt. Ihre Struktur und Bedeutung variieren jedoch je nach kulturellem Kontext. Während in einigen Kulturen die Kernfamilie im Vordergrund steht, sind in anderen erweiterte Familienstrukturen entscheidend. Die interkulturelle Vielfalt der Familienformen spiegelt nicht nur unterschiedliche soziale und wirtschaftliche Realitäten wider, sondern bietet auch spannende Einblicke in menschliches Miteinander und die Formung von Identitäten. Meine Recherchen und Umfragen in den Sozialen Medien ergaben, dass es viele positive Besipiele gibt, in denen verschiedene Familienmodelle miteinander erfolgreich kooperieren und sich ergänzen. Doch die Herausforderung im globalen Kontext besteht einerseits darin, die jeweilige Familienkultur wertzuschätzen und zugleich den gemeinsamen ganzheitlichen Menschlichkeitssinn zu fördern, um ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen. Andererseits und besonders zu betonen ist, dass für die LGBTQ+ -Community Raum für unterschiedliche Familienformen und -strukturen zu schaffen ist, oben erwähnte Nachteile im Rechtsraum aufgelöst und dafür eine Rechtssicherheit von der Regierung verankert werden muss.
Liebe Biologische Familien: Eine Wahl- oder Wunschfamilie eurer Liebsten sollte weder als Konkurrenz verstanden noch ein Wunschtraum bleiben, da sie keine Gefahr für niemanden darstellt und im Idealfall eine Bereicherung für beide Seiten sein kann! Ich halte es für bemerkenswert, dass die queere Community Widerstandskraft und Kreativität zeigt, wenn es darum geht, ihre eigenen neuen Familien zu gestalten und zu stärken bzw. mit der Herkunftsfamilie zu verbinden. Nur durch den Aufbau von solidarischen Netzwerken und Unterstützungssystemen gelingt es, ein Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft zu schaffen, das über biologische Verwandtschaft hinausgeht. Wahlfamilien könnten durch das Institut der Verantwortungsgemeinschaft eine Möglichkeit erhalten, für einander alltagspraktisch, aber auch in Extremlagen wie im Pflege- oder Todesfall, rechtliche Verantwortung zu übernehmen. Was also spricht gegen sie? Also: Fahne hoch für die Wahlfamilien!
Und Hier ein paar hilfreiche Links zum Thema:
https://www.queer-rainbow-family.lgbt/ueber-uns/
https://www.tbb-berlin.de/category/meine-familie (für die türkische Community)
Bleib‘ mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog: „Rechtsdruck in Westeuropa nach der EU-Wahl- Auswirkungen und Konsequenzen für die LGBTQ+ -Community“

Tschüssi
Dein Samuel
Aktuell Politisches/Relevantes
14.07.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu aktuellen, gesellschaftlich/politisch relevanten Themen, die mich derzeit und immer wieder bewegen.
Heute:

PINKWASHING- entlarvt!
Wie es die queere Community in Kunst und Kultur beeinflusst
Mitten im pulsierenden Kulturleben Berlins enthüllt sich ein Thema über den PRIDE MONTH hinaus von großer Bedeutung: Pinkwashing. Der Juni in Deutschland stand im Zeichen der Sichtbarkeit der lesbischen, schwulen, trans und queer lebenden Menschen, aber auch des Widerstands gegen Pinkwashing – ein Signal der Liebe und Solidarität unter Menschen. Wie aber beeinflusst diese Kontroverse im Dickicht von Kunst und Kultur die queere Community in Deutschland? Begeben wir uns auf Spurensuche, wie die Diskussion die Öffentlichkeit nicht nur Berlin prägt.
PINKWASHING: Eine gefährliche Täuschung
Durch Aktivismus, Kunst, Kultur und Bildung setzt sich die queere Community für die Rechte und Sichtbarkeit aller Mitglieder ein und trägt dazu bei, eine Gesellschaft zu schaffen, die Akzeptanz und Respekt für alle Geschlechteridentitäten und sexuellen Orientierungen zeigt.
Das war nicht immer so: Der Überbegriff der „queeren Kunst“ ist sowohl zeitalter- als auch ortsübergreifend. Darunter versteht man moderne und zeitgenössische Kunstformen, die sich auf die Darstellung der LBGTQ+ -Erfahrung beziehen. Während es definitionsgemäß keine singuläre „queere Kunst” geben kann, berufen sich zeitgenössische Künstler*innen, die ihre Praktiken als queer bezeichnen, oft auf den Begriff der queeren Kunst und beziehen sich retrospektiv auf die historische Arbeit von LGBTQ+ Künstler*innen, die ihre Kunst zu einer Zeit ausübten, bevor die heutigen Bezeichnungen „lesbisch”, „schwul”, „bisexuell”, „trans” etc. anerkannt wurden. In der Kunstgeschichte und Kritik der Vergangenheit wurde die Sexualität von Künstler*innen oftmals bewusst verschwiegen, da man homosexuelle Erfahrungen nicht einbeziehen wollte. Aufgrund der frühen Kriminalisierung homosexueller Handlungen und des vorherrschenden sozialen Stigmas bediente sich ein großer Teil der queeren Kunst einer verschlüsselten Bildsprache, des „Queer Coding“, die in der breiten Öffentlichkeit keinen Verdacht erregte, es aber denjenigen, die mit den Symbolen der Subkultur vertraut waren, ermöglichte, die verborgenen Bedeutungen zu erschließen. Die lesbischen Schmonzetten aus den 50er und 60er Jahren waren anfangs eine erschwingliche Form reizvoller Populärkunst; in einer Zeit vor der Feminismus- und LGBTQ+ -Bewegung waren die aufsehen-erregenden Illustrationen auf den Covern meist die einzige Möglichkeit für Frauen, etwas über lesbische Beziehungen zu erfahren. Wie andere Publikationen zeigte diese Literatur eine Fantasiewelt voller hanebüchenen Klischees, verführerischer Posen und makelloser Körper, markieren sie dennoch die bedeutenden Anfänge der popkulturellen Darstellung von Homosexualität in der Kunst.
Führen wir uns vor Augen, dass wir sowohl in der bildenden wie auch in der freischaffenden Kunst, also der Malerei, Musik/Gesang, Schauspiel, Tanz, Mode, Literatur u.v.m. auf bedeutende Persönlichkeiten (zurück)-blicken können:
Malerei: Der schwedische Maler Eugène Jansson (1862-1915), der nackte Männerbilder vor den Kulissen von Badeanstalten oder der Marine malte. Der Popart-Künstler Andy Warhol erlangte mit seinen Darstellungen Weltruhm.
Musik/Gesang: Was wäre die Popkultur ohne die bisexuelle Rockröhre Gianna Nannini, Freddy Mercury und David Bowie und die Musikgeschichte ohne Tchaikowski oder dem vermutlich schwulen Beethoven?
Schauspiel: Denken wir an die ehrwürdige «Mutter der Nation«, Ingrid Meisel oder an «unsere« Berlinerin Maren Kroymann, die Generationen vor uns und aktuell mit ihrer Schauspielkunst begeistern?
Tanz: Der Profitänzer und Starchoreograph Emil Kusmirek überzeugte Millionen bei «Let’s dance«.
Mode: Karl Lagerfeld, Guido Maria Kretschmer und Marc Jacobs als Ikonen der Modewelt verschönern durch ihre Fantasie, ihr Schneiderhandwerk und ihr Genie nicht nur Mann und Frau weltweit.
Literatur: Hätte «Giovannis Zimmer« ohne James Baldwin Platz 1 auf der Bestsellerliste queerer Literatur erreicht? Sie alle hatten und haben es nicht nötig, sich «pinkzuwaschen«, sie waren und sind es und überzeugen global mit ihrer Kunst nicht nur die Community, sondern jede/r profitiert davon!
Ein Gegenpol ist das sog. PINKWASHING: Darunter versteht man i.d.R. eine Marketingstrategie, bei der Unternehmen/Organisationen prifitorientiert LGBTQ+-freundliche Werbe-/Imagekampagnen oder Produkte nutzen, um von anderen fragwürdigen oder diskriminierenden Vorgehen abzulenken.
Es entsteht eine Kluft zwischen Selbstdarstellung und tatsächlichem Handeln. Beispiel: Ein Unter-nehmen, das in seinen Werbekampagnen Regenbogenflaggen und LGBTQ+-Symbole verwendet, um ein positives Image zu schaffen, obwohl es intern keine diversen oder inklusiven Arbeitsbedingungen bietet oder diese vertritt. Das ist gewiss nicht sauber, schon längst nicht porentief rein! Doch als noch erschütternder ist festzustellen, dass selbst die Politik nicht davor zurückschreckt, sich daran ein Beispiel zu nehmen und diese Methodik rücksichtslos für ihre eigenen Zwecke ausnutzt: Eine Partei oder gar eine Regierung, die sich öffentlich als LGBTQ+-freundlich darstellt, aber gleichzeitig Gesetze oder Maßnahmen unterstützt oder umsetzt, die LGBTQ+-Rechte einschränken oder diskriminieren. Auch das ist eindeutig Pinkwashing, wenn auch die Regierenden das in aller Öffentlichkeit dementieren. Also ist Vorsicht geboten vor dieser schamlosen Augenwischerei von Firmen und Konzernen zur Gewinnoptimierung oder vor Prestigehascherei in der Politik.
Was bedeutet das für unsere Kunst und Kultur?
Menschen der queeren Community, speziell in den Kulturhauptstädten, müssen wachsam sein, denn PINKWASHING halte ich für eine gefährliche Täuschung! Unter dem Deckmantel vermeintlicher Unterstützung verbirgt sich oft eine manipulative Agenda. Ist es tatsächlich so, dass durch dieses Instrument tief in die Vielfalt der queeren Lebensweisen eingegriffen und versucht wird, sie zu kontrollieren? Werden trans-, schwul- und non-heteronormative Menschen für eine oberflächliche Akzeptanz instrumentalisiert? Die Antwort ist ein eindeutiges JA! Kunst und Kultur werden beim Pinkwasching als Werkzeuge genutzt, um das Leben queerer Menschen zu beeinflussen. Die Suche nach echter Anerkennung und Solidarität wird dabei erschwert.
Auswirkungen auf die queere Community: Zwischen Anerkennung und Ausbeutung:
Die Auswirkungen von PINKWASHING auf die queere Community sind vielschichtig und oft ambivalent. Während die Anerkennung queerer Lebensweisen in Kunst und Kultur positiv erscheinen mag, besteht die Gefahr der Ausbeutung und Vereinnahmung. Berlin, Karlsruhe und andere Städte in Deutschland sind Schauplätze, wo dieses Spannungsfeld besonders deutlich wird. Die queere Community sucht nach authentischen Darstellungen und echter Solidarität, nicht nach oberflächlicher Inszenierung! Die Vielfalt queerer Identitäten und Lebensrealitäten darf nicht für kommerzielle Zwecke missbraucht werden. Es ist entscheidend, dass die queere Community selbst die Deutungshoheit über ihre Kultur behält und sich gegen jegliche Form von Ausnutzung und oberflächlicher Ausbeutung ihrer Identität zur Wehr setzt. Liebe, Respekt und Anerkennung sollten im Zentrum stehen, nicht Ausbeutung und Täuschung, stimmt’s?
Mein Fazit: Die queere Community unterstützen zum Erhalt ihrer Kunst und Kultur
Die queere Community darf nicht länger Spielball von PINKWASHING sein, sondern muss mit vereinten Kräften für echte Anerkennung und Unterstützung eintreten. Es geht um den Schutz von Kunst und Kultur einer Gemeinschaft, die für Solidarität und Wahrhaftigkeit eintritt. Inmitten der Diskussionen über PINKWASHING und dessen Auswirkungen bleibt ein entscheidender Fokus: Die Stärkung und Unterstützung der vielfältigen queeren Lebensentwürfe. Es ist von zentraler Bedeutung, dass die queere Community nicht nur in Berlin, Karlsruhe und ganz Deutschland zusammenhält, sondern ebenso weltweit, um sich gegen die Manipulation durch pinkgewaschene Begriffe und Konzepte zu wehren Es ist an der Zeit, gemeinsam zu handeln, um die die LGBTQ+-Gesellschaft vor Ausbeutung zu schützen und sie in ihrer Vielfalt zu feiern. Nur so kann eine starke und unterstützende Gemeinschaft entstehen, die für alle ein sicherer Hafen in einer manchmal noch unsicheren Welt ist
Bleib‘ mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog: „Familie und Wahlfamilie: Wenn Utopie auf Realität trifft“

Tschüssi
Dein Samuel
Aktuell Politisches/Relevantes
02.06 .2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu aktuellen, gesellschaftlich/politisch relevanten Themen, die mich derzeit und immer wieder bewegen.
Heute:
Aktuell Politisches/Relevantes
Wählen gehen für eine bessere, solidarische und tolerante Zukunft– für uns alle.
Ein Statement als queerer Autor für die LGBT+ – Gemeinschaft mit Migrationsgeschichte
Die Europawahlen stehen vor der Tür und es liegt an einem jeden, die Macht des Wahlrechts zu nutzen. Alle, selbstverständlich auch ich als Mitglied der LGBTQ+ Gemeinschaft und alle Bürger*innen mit Migrationsgeschichte, haben nicht nur das Privileg zu wählen, sondern auch die Verantwortung – gleich welcher Religionszugehörigkeit – die eigene Stimme zu erheben, uns für unsere Rechte und Freiheiten einzusetzen und unser Schaffen in Kunst und Kultur zu sichern.
In einer Zeit, in der rechtsextreme Parolen, Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus zunehmend Einzug in unsere Gesellschaft halten und gegen Vielfalt und Toleranz spürbaren Kampf aufnehmen, haben wir die Möglichkeit, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen. Unsere Stimmen bei der Europawahl, egal welcher Herkunft und Identität, haben die Kraft, Veränderungen herbeizuführen und denjenigen entgegenzutreten, die unsere Rechte und Existenz bedrohen.
Als queere Bürger*innen, auch mit Migrationsgeschichte, spielen wir eine wichtige Rolle bei den Europawahlen. Unsere vielfältigen Perspektiven und Erfahrungen bereichern die politische Landschaft und können dazu beitragen, Diskriminierung zu bekämpfen und Solidarität zu stärken. Durch unsere Teilnahme an den Wahlen zeigen wir, dass wir als queere Gemeinschaft zusammenhalten und uns für eine gerechte und inklusive Gesellschaft einsetzen.
Kürzlich habe ich dazu eine Befragung an meinem Arbeitsplatz gemacht, an dem viele Mitarbeiter*innen aus diversen Nationen arbeiten, die zumeist die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und damit wahlberechtigt sind. Mit ihnen sprach ich über Politikverdrossenheit und mangelndes Vertrauen in Wahlen. Dies betrifft, vor allem bei jungen Erwachsenen, die Teilnahme an der kommenden Europawahl. Anhand einzelner Geschichten bestätigte sich mir, dass das berechtigten Gründe hat. Ich habe eine Vielzahl an Stimmen gehört, die ein kunterbuntes Mosaik der Vielfalt spiegelte. Eine Auswahl davon stelle ich euch hier vor:
Sharin, 32, sprach über die Herausforderungen, die sie als queere Frau in ihrer iranischen Heimat erlebt hatte. Sie erzählte von ihrem Wunsch nach Freiheit und Gleichberechtigung. „Im Iran erlebte ich Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen in den Gesetzen, der Rechtsprechung und in der gesellschaftlichen Einstellung mit ungebrochener Härte. Seitdem Ebrahim Raisi 2021 Präsident des Iran wurde, hat sich die Brutalität der Sittenpolizei zunehmend verschärft, was zu Folter, gewaltsamem Verschwindenlassen und Ermordung von Frauen, insbesondere von Frauenrechtsaktivistinnen, geführt hat.“ Auf meine Frage, was sie sich für Europa wünsche, erhielt ich als Antwort: „Ich bin zutiefst dankbar, dass ich durch meine inzwischen erlangte, deutsche Staatsbürgerschaft die Möglichkeit habe, an Wahlen teilzunehmen. Ich träume davon, in einer Welt zu leben, in der meine Liebe nicht kriminalisiert wird. Durch die Europawahlen will ich dazu beitragen, dass so etwas wie meine Geschichte den queeren Europäern erspart bleibt.“
Tarik, 17, dessen Eltern aus der Türkei nach Deutschland einwanderten, berichtete lebhaft von den kulturellen Reichtümern des Heimatlandes seiner Familie und der Liebe, die sie für die Türkei empfinde. Gleichzeitig ließ er jedoch die Unterdrückung und die Schwierigkeiten spüren, denen queere Menschen in der Türkei gegenüberstünden. „Als schwuler Mann in der Türkei fühle ich mich gefangen zwischen meiner sexuellen Identität und den traditionellen, gesellschaftlichen Erwartungen. Homosexualität wird nicht nur in den ländlichen Regionen, sondern mittlerweile verstärkt auch in den Großstädten überwiegend als Tabu betrachtet und durch das autokratische Regime sogar mit Verfolgung und Gefängnis konfrontiert. Das erzeugt in mir große Angst und Sorge. Ich bin sicher, dass die Europawahlen eine Chance bieten, für eine gemeinschaftliche Zukunft eines vereinten Europas zu stimmen, in der meine Identität respektiert und geschützt ist – eine Zukunft, in der die queere Community ihre Stimme erheben kann, ohne Angst vor Entwürdigung und Unterdrückung. Deswegen wähle ich aus Überzeugung, und ich freue mich, das mit meinen 17 Jahren machen zu dürfen.“
Sergeij, 24, ist vor fünf Jahren von Russland nach Berlin emigriert. Er sprach über die kulturelle Vielfalt seines Landes und die reiche Geschichte, die ihn geprägt hatte. Gleichzeitig machte er auf die zunehmende Homophobie und die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Russland aufmerksam, die ihn schließlich veranlasst hatte, nach Europa auszureisen. „Ich habe die russische Staatsbürgerschaft bewusst abgegeben und die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, weil ich ein Teil von Europa sein möchte. Bei der letzten Präsidentschaftswahl in Russland kam es zu Fälschungen der Wahlergebnisse und Verstößen gegen die Wahlregeln. Ich habe, trotz einiger Vorbehalte, Vertrauen in die Vertreter der europäischen Politik und möchte meine Stimme bei der Wahl für ein freies Europa nutzen, das auch mit seiner Geschichte, seiner Kunst und Kultur eine Bereicherung für mich ist.“
Jadwiga, 45, lebt seit mehr als zwanzig Jahren in Deutschland. Sie sprach über die einstige kulturelle Renaissance und die lebendige LGBTQ+ Community in ihrer polnischen Heimat. „Es ist erschreckend, welche Entwicklung unser Land in den letzten Jahren durchlaufen hat. Im privaten Umfeld erlebe ich zunehmende Angriffe auf die Rechte der LGBTQ+ Personen in Polen und der wachsenden Bedrohung durch rechte Extremisten. Das muss aufhören! Deshalb wähle ich in Deutschland als stolze EU-Bürgerin, um dagegen meine Stimme zu erheben. Ich möchte durch meine Wahl für Europa eine bessere Perspektive bewirken, besonders für die queere Gesellschaft.“
Mir ist durch deren eindrucksvollen Schilderungen deutlich geworden, dass wählen zu gehen nicht nur eine Bürgerpflicht ist, sondern uns allen durch das Privileg freier Wahlen die Chance geboten wird, die Bedeutung der Diversität und deren Zusammenarbeit über Grenzen hinweg zu betonen, die sich auch in Kunst und Kultur widerspiegelt. Gemeinsam können queere Bürger*innen mit Migrationsgeschichte eine starke Stimme für Gleichberechtigung und Toleranz sein, für eine solidarische und vielfältige Zukunft, für uns alle. Nutzen wir sie!
Jede einzelne Stimme zählt – auch deine!
Bleibt mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog: „PINKWASHING– entlarvt!“

Bleib‘ mutig und stark!
Tschüssi
Dein Samuel
Aktuell Politisches/Relevantes
12.05 .2024 – Samuel Coenigsberg
 Machst Du mit?
Machst Du mit?
Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, ich dem ich euch auf eine neue Themenreihe mitnehmen möchte zu aktuellen, gesellschaftlich/politisch relevanten Themen, die mich derzeit und immer wieder bewegen.
Heute: IDAHOBIT am 17.05.2024
– In Vielfalt geeint? -, stimmt das?
Auch dieses Jahr ist der IDAHOBIT von entscheidender gesellschaftlicher Bedeutung. Ich sehe trotz einiger Fortschritte in den vergangenen Jahren, dass LGBTQ+ -Personen immer noch Opfer von Diskriminierung, Hass und Gewalt sind und unter nachhaltigen psychischen Folgen leiden. Radikalisierung, Populismus und die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nehmen nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in ganz Europa zu. Vom beharrlichen Antisemitismus ganz zu schweigen. Und nicht nur das: In einigen außereuropäischen Ländern und Staaten wird sogar vor menschenverachtender Entwürdigung bis hin zur Tötung von queeren Menschen nicht Halt gemacht. Das schockiert mich und macht mich wütend. Was ist das nur für eine Welt, frage ich mich immer wieder entsetzt. Ich will nicht hilflos und ohnmächtig sein. Also: Was tun? Die entscheidende Frage lautet: Wo trage ich als Teil der Menschheits-Gesellschaft eine Mitverantwortung an dieser Entwicklung, und welche Möglichkeiten kann ich ergreifen, um effektiv etwas gegen diese global herrschende Praxis der Verletzung der Menschenrechte- und Würdigung zu tun? Und: Darf ich glauben, was die Medien über die gepriesene, weltweite Anerkennung von LGBTQ+ -Personen verbreiten? Ich bin da eher skeptisch und habe mich auf Recherche begeben. Zunächst:
Warum feiert man den IDAHOBIT genau am 17. Mai? Das Datum für den „IDAHOTB“ (= International Day Against Homophobia, Transphobia & Biphobia) wurde speziell ausgewählt, da bereits am 17. Mai 1990 die WHO beschlossen hatte, Homosexualität nicht mehr als geistige Störung einzustufen, ein erster bedeutender Schritt in die richtige Richtung.
Was ist der „IDAHOBIT“ und wofür steht er? Jedes Jahr stehen politische Entscheidungsträger, Meinungsführer, die Medien und die breite Öffentlichkeit vor der Herausforderung, sich mit der dringenden Notwendigkeit auseinanderzusetzen, Gewalt und Diskriminierung gegen LGBTQ+ -Personen zu bekämpfen und integrative Gesellschaften aufzubauen, die durch ihre Vielfalt bereichert werden. Der IDAHOBIT dient nicht nur als Erinnerung an die Notwendigkeit von Akzeptanz und Gleichberechtigung, sondern unterstützt auch sozialpolitische Maßnahmen zur Stärkung der Rechte und Sicherheit von LGBTQ+ Menschen.
Wo wird der IDAHOBIT überall gefeiert – und wo nicht? Laut einer Veröffentlichung von Focus online am 17.05. 2023 wurde im vergangenen Jahr „in mehr als 130 Ländern dieser Erde der IDAHOBIT gefeiert, darunter auch in 37 Ländern, in denen gleichgeschlechtliche Aktivitäten illegal sind. Tausende Initiativen, darunter kleine und große, sind über die ganze Welt verteilt gemeldet. Auch von offizieller Seite wird der IDAHOBIT von einigen Staaten anerkannt, auch internationale Institutionen wie das Europäische Parlament und zahllose lokale Gemeinden. Viele UN Behörden veranstalten an diesem Tag spezielle Events“.
Ein Blick über den Tellerrand verrät: Von Gefängnis bis Galgen reichen die Orte, die LGBTQ+ -feindliche Staaten auf dieser Welt als angemessen für Lesben, Schwule, Trans* und intergeschlechtliche Menschen betrachten. In insgesamt 13 europäischen Ländern können gleichgeschlechtliche Paare inzwischen heiraten – mit allen Rechten, die auch Heterosexuelle genießen. Dem gegenüber stehen elf Staaten, in denen homosexuelle Paare zwar ihre Partnerschaft eintragen können, jedoch nicht dieselben Rechte wie heterosexuelle Ehepartner haben. Besonders bitter sieht es für Schwule und Lesben in Osteuropa aus: In Polen, der Ukraine, Moldawien, Weißrussland, Albanien und Litauen ist nicht nur die „Ehe für alle“ oder die eingetragene Partnerschaft verboten. Queer wird auch in großen Teilen der Gesellschaft nicht akzeptiert, tabuisiert oder gar von der Regierung bekämpft. In vielen dieser Länder leben LGBTQ+ aus Angst vor Übergriffen weiterhin versteckt. Schaut man sich die Weltkarte der international Lesbian and Gay Association (ILGA) zum rechtlichen Status von Lesben, Schwulen, Bi- und Intersexuellen sowie Transgender weltweit an (ILGA-Weltkarte), so sind nach Untersuchungen der Eddy-Hirschfeld-Stiftung 70 Verfolgerstaaten mit homophobem Strafrecht zu verzeichnen, unter anderem darunter sieben Staaten, in denen LGBTQ+ von der Todesstrafe bedroht sind (Iran, Jemen, Mauretanien, Saudi-Arabien, Sudan, Teile von Nigeria und Somalia). Daneben existieren muslimische Staaten des Nahen und Mittleren Ostens sowie Nordafrikas, die einen homogenen homophoben Block bilden, ehemalige britische Kolonien mit mehrheitlich homophobem Strafrecht, ehemalige französische Kolonien, die entweder entkriminalisiert (Gabun, Madagaskar, Indochina) oder das koloniale Strafrecht beibehalten haben (Libanon, Senegal oder Togo); der afrikanische Block mit Strafgesetzen in über 30 Staaten (rühmliche Ausnahme: Südafrika, dem eine Vorbildfunktion zukommt); 20 asiatische Staaten, die Homosexuelle strafrechtlich verfolgen und zehn karibische (englischsprachige) Inselstaaten, in denen homosexuelle Handlungen verfolgt werden. Hier wird ganz bestimmt nicht der IDAHOBIT frei gefeiert, und wenn, dann nur unter dem eigenen erhöhten Risiko. Nur 115 Staaten gelten als tolerant oder gefahrlos.
Mein Fazit: Jeder Mensch, der sich für die Rechte der LGBTQ+ Gemeinschaft einsetzt, steht vor verschiedenen Herausforderungen, wie Vorurteile, Widerstände, Unverständnis und sogar Feindseligkeit in der Gesellschaft. Es erfordert auch bei mir Mut, Empathie und Ausdauer, um für die Gleichstellung und Akzeptanz von LGBTQ+ -Personen zu kämpfen und mich für ihre Rechte einzusetzen, im privaten Umfeld wie auch im internationalen Engagement. Insgesamt sehe ich den IDAHOBIT-Tag als einen wichtigen Anlass, um Solidarität zu zeigen, Bewusstsein zu schaffen und Veränderungen anzustoßen. Es liegt an jedem Einzelnen von uns, sich aktiv für die Rechte und die Würde der LGBTQ+ -Gemeinschaft einzusetzen und gemeinsam eine inklusive und chancengleiche Gesellschaft aufzubauen, damit ein jeder diesen Tag gebührend feiern kann! Lasst uns nicht aufgeben, dafür zu kämpfen, jeder auf seine eigene Art oder in gemeinschaftlichem, organisiertem Tun!
In Vielfalt geeint!
Bleibt mutig und stark!

Bis zum nächsten Blog,: „Europawahl“
Tschüssi
Dein Samuel
Themenreihe: "Die bunte Welt der Vielfalt"
3.) "Transition. Definition, Verfahren, Behandlung"
21.04.2024 – Samuel Coenigsberg

Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, der euch wieder wertvolle Informationen und Angebote für Eltern, Fachkräfte und Familien bietet. Worum geht es?
Es geht ergänzend weiter in meiner Themenreihe, anlässlich des kürzlich stattgefundenen Internationalen Tages der Transsichtbarkeit vom 26.03.2024 und passend zum 12.04.2024, dem Tag, an dem das neue Transsexuellengesetz beschlossen wurde.
Habt ihr schon einmal eine Person getroffen, die euch erzählt hat, dass sie sich in der Vorbereitung einer Geschlechtsangleichung befinde? Im letzten Blog hatte ich euch von der geschlechtsangleichenden Behandlung eines Transmannes berichtet. Wie aber sieht das Verfahren bei einer Transfrau aus?
Zur Erinnerung: Was versteht man eigentlich unter einer Transition?
Die Definition lautet: Körperliche Geschlechtsumwandlung mit dem Ziel, sich durch eine körperliche Geschlechtsangleichung danach im eigenen Geschlechtskörper stimmiger, wohler und zufriedener zu fühlen.
Wie ist das allgemeine Verfahren?
Trans*Menschen – egal, welchen Geschlechts – müssen zu Beginn der Transition beweisen, dass sie sich ihrer Sache sicher sind und einen sog. Alltagstest absolvieren. Unter Alltagstest versteht die Selbsterfahrung bzw. Selbsterprobung im Identitätsgeschlecht, indem der Betroffene durchgängig in allen sozialen Bezügen in der angestrebten Geschlechtsrolle lebt. Dieser wird oft von der Krankenkasse bzw. der/dem zuständigen Psychotherapeut*in als Voraussetzung verlangt, bevor erste Schritte unternommen werden. Alle weiteren Schritte und zu beachtende Punkte könnt ihr im vorigen Blog gerne noch einmal nachlesen, denn sie gelten auch selbstverständlich für die Transfrau.
Teil II: Die Transfrau – Die Feminisierung des Körpers
So schaut der Behandlungsweg aus:
Sichtbare feminine Veränderungen durch Hormone: Die Behandlung mit feminisierenden Medikamenten wird von Ärzt*innen für Endokrinologie durchgeführt. Zunächst ist ein prätherapeutisches Risikoscreening notwendig. Weibliche Hormone (Östrogene) können als Tabletten oder über Gels/Pflaster gegeben werden. Manche Endokrinolog*innen empfehlen zusätzlich zu den Östrogenen sogenannte Antiandrogene. Das sind Medikamente, die noch wirksames körpereigenes Testosteron blocken. Die Wirkungen dieser Behandlungen zeigen sich in einer allmählichen Feminisierung des Körpers: die Haut wird weicher, die Brust beginnt sich zu vergrößern, Hoden und Genitalien verkleinern sich, die Fähigkeit zur Erektion und Ejakulation nimmt ab, das Körperfett verteilt sich anders und die Körperbehaarung geht langsam zurück. Der Bartwuchs wird unter dem Einfluss von Östrogenen und Antiandrogenen aber nicht gestoppt und auch die Stimmlage verändert sich nicht. Außerdem kann sich das Verlangen nach Sexualität abschwächen.
Feminisierende Operationen im Genitalbereich: Die feminisierende Operation wird in zwei Sitzungen durchgeführt. In der ersten, der aufwändigeren Operation, werden zunächst die Schwellkörper und Hoden entfernt, dann ein Raum zwischen Harnblase und Enddarm geöffnet, in den die Haut des Penis zur Neovagina eingestülpt wird. Aus der Eichel wird die Klitoris, aus der Hodensackhaut werden die Schamlippen gebildet. Nach mehreren Monaten werden in einem zweiten Eingriff kosmetische und funktionelle Korrekturen vorgenommen. Die Fähigkeit zum Orgasmus bleibt in der Regel erhalten.
Feminisierende Operationen im Brustbereich: Diese Operation ist nur notwendig, wenn es unter Einnahme von Östrogenen nicht zu einer ausreichenden Ausbildung einer weiblichen Brust gekommen ist. Operativ werden in der Regel Silikonprothesen implantiert, die in verschiedenen Formen und Ausführungen vorhanden sind. Wichtig ist es, sich vorher gut und ausführlich ärztlich beraten zu lassen.
Feminisierung der Stimme: Ein Erhöhen der Stimmlage kann durch Logopädie geübt werden. Selten wünschen trans* Personen eine Operation der Stimmbänder, wenn die Logopädie nicht zum Erfolg führt.
Korrektur des Adamsapfels: Um den Adamsapfel zu verkleinern, stehen verschiedene Operationsmethoden zur Verfügung, die als sicher und komplikationslos gelten.
Abschließende Frage:
Können Trans*-Personen auch Kinder bekommen? Eine Frage, die viele vor ihrer Entscheidung zur Transition bewegt. Was wir wissen: Unter der Einnahme von Hormonen wird im Laufe der Zeit die eigene Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigt. Operationen an den Fortpflanzungsorganen mit Entfernung der Keimdrüsen führen sogar zu einer Fortpflanzungsunfähigkeit. Was ist also, wenn trotzdem ein Wunsch besteht, eigene Kinder zu bekommen?
Auf jeden Fall ist es ratsam, sich vor der Transition mit dieser Frage auseinanderzusetzen, um den richtigen Zeitpunkt der Konservierung eigener Keimzellen nicht zu verpassen. Am besten ist es, sich spätestens während des Beratungsgespräches in der Endokrinologie über individuelle Möglichkeiten beraten und an Ärzt*innen, die sich mit Fruchtbarkeitsbehandlungen auskennen, überweisen zu lassen.
Es gibt – insbesondere für biologisch männliche Personen – die Möglichkeit der „Kryokonservierung“. Dazu werden Keimzellen (Samen- oder Eizellen) mittels flüssigen Stickstoffs tiefgefroren, sie können lange aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt zur Befruchtung verwendet werden. Bei Samenzellen funktioniert das sehr gut, bei Eizellen ist die Erfolgsquote geringer.
Biologisch weibliche Menschen stehen im Zuge der Maskulinisierung, spätestens im Zusammenhang mit der operativen Entfernung von Gebärmutter und Eierstöcken vor der Frage, ob sie noch eigene Kinder bekommen können wollen. Wird diese Operation nicht durchgeführt, so besteht zu einem späteren Zeitraum trotz Einnahme von Hormonen die Möglichkeit, eigene Kinder auszutragen. Dazu müssen allerdings über einen bestimmten Zeitraum die männlichen Hormone wieder abgesetzt werden, bis die ursprüngliche Fruchtbarkeit wieder hergestellt ist. Übrigens, keine Angst, die äußerlich sichtbare Vermännlichung ist davon nicht beeinträchtigt.
Hier noch ein paar Links zu beeindruckenden Zeugnissen von Transfrauen:
https://www.ardmediathek.de/video/alles-liebe/liebeswandel-transfrau-liebt-frau/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE3NjAyMzU
https://www.regio-tv.de/mediathek/video/im-falschen-k%C3%B6rper-geboren-eine-transfrau-erz%C3%A4hlt-aus-ihrem-leben/
https://www.youtube.com/watch?v=-sahbI8O7OA (ab 06:24)
Hilfsangebote für queere und Trans* -Personen in Deutschland:
https://trans-ident.de/beratung/
Startseite
https://www.vlsp.de/lebenswelten/transition-geschlechtsangleichung/welche-unterstuetzung-sieht-das-gesundheitssystem
https://schwulenberatungberlin.de/
Bleibt mutig und stark!
Bis zum nächsten Blog,: „IDAHOBIT“

Tschüssi
Dein Samuel
Themenreihe: "Die bunte Welt der Vielfalt"
3.) "Transition. Definition, Verfahren, Behandlung"
30.03.2024 – Samuel Coenigsberg

Liebe Alle,
herzlich willkommen in meinem Blog, der wertvolle Informationen und Angebote für Eltern, Fachkräfte und Familien bietet. Worum geht es?
Im zweiten Band der „Que(E)rflug“-Dilogie lernt Levy mit einer ungeahnten Überraschung den Transmann Bruno kennen. Der sprach davon, dass er in der Vorbereitung einer Geschlechtsangleichung sei. Wie es ihm dabei ergangen haben mag, stelle ich in diesem Blog vor. Es geht ergänzend weiter in meiner Themenreihe, anlässlich des kürzlich stattgefundenen Internationalen Tages der Transsichtbarkeit vom 26.03.2024
Was versteht man eigentlich unter einer Transition?
Die Definition lautet: Körperliche Geschlechtsumwandlung mit dem Ziel, sich durch eine körperliche Geschlechtsangleichung danach im eigenen Geschlechtskörper stimmiger, wohler und zufriedener zu fühlen.
Mitten im bunten Meer der Möglichkeiten, wenn es um Hilfen für eine Geschlechtsangleichung geht, kann es manchmal schwierig sein, den richtigen Ankerpunkt zu finden. Bis vor wenigen Jahren war in der Medizin immer noch die Vorstellung maßgebend, Männer zu Frauen beziehungsweise Frauen zu Männern „umzuwandeln“. Heute existiert ein erweitertes Verständnis über die Geschlechtskörper und diversen Identitäten des Menschen. Diese zeigen eine unendliche Vielfalt auf, die immer individuell nuanciert ist. Diese Erkenntnis ist befreiend für diejenigen, die sich vielleicht nur teilweise körperliche Veränderungen wünschen. Niemand sollte sich unter Druck setzen, durch eine Transition die Prototypen Mann oder Frau zu erreichen. Die Herausforderung ist vielmehr persönlich auszutarieren, wie viel Vermännlichung (Maskulinisierung) beziehungsweise Verweiblichung (Feminisierung) für sich selbst richtig und notwendig ist und wie viel nicht. Es soll gelingen, mit so wenig körperlichen Behandlungen wie möglich, sich im eigenen Körper wohlzufühlen.
In den frühen Phasen der Transition ist Unterstützung von entscheidender Bedeutung, um ein starkes Fundament für den weiteren Weg zu legen. Hilfe in Form von Beratung, psychologischer Unterstützung und Austausch mit Gleichgesinnten kann dabei helfen, die Herausforderungen anzugehen und sich sicher zu fühlen. Es ist wichtig, sich nicht alleine zu fühlen, sondern Teil einer unterstützenden Gemeinschaft zu sein, die Verständnis und Empathie bietet. Hilfen findet ihr am Schluss des Blogs!
Wie ist das allgemeines Verfahren?
Trans*Menschen müssen zu Beginn der Transition beweisen, dass sie sich ihrer Sache sicher sind und einen sog. Alltagstest absolvieren. Unter Alltagstest versteht die Selbsterfahrung bzw. Selbsterprobung im Identitätsgeschlecht, indem der Betroffene durchgängig in allen sozialen Bezügen in der angestrebten Geschlechtsrolle lebt. Dieser wird oft von der Krankenkasse bzw. der/dem zuständigen Psychotherapeut*in als Voraussetzung verlangt, bevor erste Schritte unternommen werden.
Es folgen:
Juristische Namens- und Personenstandsänderung (oft langwieriges und kostenintensives Verfahren mit Gutachten und Gerichtstermin); Hormonersatztherapie (Hormone müssen lebenslang zugeführt werden, um ihren Effekt zu behalten); Körperangleichende Operationen (z.B. Angleichung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale)
Für nicht-binäre Personen sind einige der medizinischen und juristischen Schritte nur sehr schwer oder über Umwege zu erreichen, da das System auf ein binäres Geschlechterbild ausgerichtet ist.
Wie hoch sind die Kosten? Die gesamten Kosten für eine Geschlechtsumwandlung variieren je nach Umfang und Dauer der Behandlung. Sie bewegen sich in einer Preisspanne zwischen 5.000 Euro und 15.000 Euro.
Wichtig: Eine Operation des Genitals betrifft einen der sensibelsten Bereiche unseres Körpers, und dieser Teil verdient fürsorgliche Beachtung. In einer Entscheidung zur Operation sollte sich bewusst gemacht werden, dass alle chirurgischen Eingriffe mit Risiken und Komplikationen verbunden sind. Einzelne chirurgische Transitionsschritte sind:
Teil I: Der Transmann
Erstens: Mastektomie: Entfernung der Brustdrüsen unter besonderer Beachtung der Lage der Narben sowie der Formung der Brust mit Betonung des darunter liegenden Brustmuskels. Hierbei kommen alle gängigen Techniken zum Einsatz zur Konstruktion einer „gestielten“ weiblichen Brustwarze.
Zweitens: Total laparoskopische Hysterektomie und Adenektomie: Entfernung der Gebärmutter, Eileiter und Eierstöcke per Schlüssellochtechnik über den Bauchraum. Die Organentnahme erfolgt von vaginal.
Drittens:Klitorispenoid („Klitpen“): Mobilisierung und Streckung der Klitoris, Verlängerung der Harnröhre aus den kleinen Schamlippen von der ursprünglichen Harnröhrenöffnung bis zur Klitorisspitze. Dadurch ist meist das Wasserlassen im Stehen möglich.
Viertens: Penoidaufbau („Phalloplastik“/großer Aufbau): Insbesondere bei der Phalloplastik (s.u.) ist ein erhöhtes Risiko von Komplikationen mit zum Teil mehrfachen Nachoperationen zu bedenken. Das Penoid wird an anatomisch korrekter Stelle implantiert. Nerven, Gefäße und die Harnröhre von Penoid und Klitorispenoid werden miteinander verbunden.
Fünftens: Plastik/Eichelnachbildung): Eichelnachbildung durch spezielle Schnittführung, Naht und ggf. Transplantation eines Hautstreifens.
Sechstens: Verschluss der Harnröhre: Endgültiger Anschluss der neu gebildeten Penoid-Harnröhre.
Siebtens: Skrotumkonstruktion: Im selben Schritt erfolgt der Aufbau eines Hodensacks (Neoskrotum) aus dem Hautmaterial der ehemaligen Schamlippen.
Erektionsprothese: Um das Penoid für penetrierenden Geschlechtsverkehr versteifen zu können, wünschen viele Patienten die Implantation einer Erektionsprothese. Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von Prothesen.Die Prothese muss nach dem Eingriff ca. 6-8 Wochen in Ruhe einheilen. Erst dann ist nach einer Einweisung die Benutzung möglich.
Weitere Korrektur-Schritte können sein: Fistel-Verschluss, Narbenkorrekturen oder Harnröhrenrekonstruktionen können entweder zusammen mit o.g. Schritten oder in separaten Eingriffen durchgeführt werden. Erfahrungsberichte (positive, aber auch negative) anderer Trans-Menschen über unterschiedliche OP-Techniken verschiedenster Operateur*innen im In- und Ausland können hilfreich sein.
Hilfsangebote queer durch Deutschland:
https://www.vlsp.de/lebenswelten/transition-geschlechtsangleichung/welche-unterstuetzung-sieht-das-gesundheitssystem
https://trans-ident.de/beratung/
https://trans-ident.de/beratung/
https://csw.berlin/wp-content/uploads/BehandlerInnen-Liste-des-BehandlerInnen-Netzwerks-TRANSIDENTIT%C3%84T.pdf
Und hier ein Youtube- Video:
Bis zum nächsten Blog, „Transition, Teil II: Die Transfrau“

Bleib‘ mutig und stark!
Tschüssi
Dein Samuel
Themenreihe: "Die bunte Welt der Vielfalt" 2.) "Mein Vater sagt, er sei jetzt meine Mutter. Nun habe ich zwei davon" Transgender: Allgemeines, Erfahrungsberichte, Unterstützungsangebote
17.03.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Freunde,
heute geht es weiter in meiner Themenreihe, nämlich:
Transsexualität in der Familie: Ein einfühlsamer Blick auf die Erfahrungen eines 40-jährigen Vaters
Wisst ihr du eigentlich, was transidente Geschlechter sind? 🌈
Transgender und transident können Personen beschreiben, die sich nicht mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Die Begriffe haben jedoch unterschiedliche Konnotationen, so dass sie nicht synonym verwendet werden können. Auch können die Begriffe von trans*- Personen sowohl als Selbst- aber auch als Fremdbezeichnung genutzt und/oder gesehen werden, weshalb stets auf die individuelle Selbstbezeichnung einer trans*- Person geachtet werden soll! Es kann nämlich eine schmerzhafte Erfahrung sein, wenn ihnen aufgrund von körperlichen Merkmalen oder sozialem Verhalten eine falsche Geschlechtsidentität zugeordnet wird. Das Leiden unter einer falsch angenommenen Geschlechtsidentität wird übrigens Geschlechtsdysphorie genannt.
„Transsexuell“ basiert vor allem auf die Kategorien Mann/Frau. Wenn trans*- Personen „transsexuell“ als Selbstbezeichnung nutzen, kann damit ausgedrückt werden, dass ihre geschlechtliche Identität das „Gegengeschlecht“ von dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht ist. Transsexualität wird im 2018 von der WHO veröffentlichten, überarbeiteten System unter dem Überbegriff „sexueller Gesundheitszustand“ („sexual health condition“) geführt und als „Geschlechtsinkongruenz“ bezeichnet. Bis dahin zählte Transsexualität der WHO zufolge zu den „psychischen und Verhaltensstörungen“ oder wurde eine „Störung der Geschlechtsidentität“ genannt. Wer sich selbst nicht eindeutig in einem dieser beiden Geschlechter wiederfindet, ist »nicht-binär*«. Dafür werden aber auch andere Begriffe verwendet, etwa die englische Variante »non-binary« aber auch »genderqueer«. Die Nutzung von „transsexuell“ zur Beschreibung von trans*- Personen durch cis Personen, wird wegen des historischen Kontexts häufig als diskriminierend angesehen und von „Betroffenen“ abgelehnt. Ab den 1950er Jahren war ,,Transsexualität‘‘ von der Medizin und Psychologie als Krankheit definiert und als solche in der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD) gelistet. Diese Einordnung beförderte die Stigmatisierung von trans*- Personen.
„Transgender“ bezieht sich auf das englische Wort für das soziale Geschlecht „gender“. Die Bezeichnung kam in den 1970er Jahren auf, als trans*-Personen in der Öffentlichkeit sichtbarer wurden. Damit schloss sich eine Lücke zwischen dem medizinischen und nur zwei Geschlechter kennenden Begriff „transexuell“ und dem auf zeitweiliges Ausleben des anderen Geschlechts hinweisenden Begriff „Travesti“. Der Bezug auf das englische Wort „gender“ soll ermöglichen, dass auch Menschen, die eine andere Geschlechtsidentität als männlich oder weiblich haben, sich mit ihm identifizieren können.
„Transident“
Transident ist neben trans*-geschlechtlich ein weiteres Wort für „transgender“. Als Selbstbezeichnung wird es genutzt, um den Aspekt der Identität, die sich mit der Geschlechtszugehörigkeit beschäftigt, zu betonen. Trotzdem hängt es auch in diesem Fall von der individuellen Person ab, ob sie sich mit diesem Begriff bezeichnen möchte, oder eine andere Bezeichnung als passender für sich empfindet.
Heute möchte ich besonders über Transfrauen sprechen, die oft viele Herausforderungen überwinden müssen, um einfach sie selbst sein zu können. 💪Besonders Transfrauen durchlaufen eine komplexe Reise, um ihr wahres Selbst zu finden und anzuerkennen. 💖Die Geschichte und Entwicklung der Anerkennung von Transfrauen ist geprägt von Mut, Widerstand und Fortschritt. In einer Welt, die oft noch von binären Geschlechtervorstellungen geprägt ist, kämpfen Transfrauen für Akzeptanz, Gleichberechtigung und Respekt. Es ist wichtig, ihre Stimmen zu hören und ihre Geschichten zu verstehen, um eine inklusivere und solidarischere Gesellschaft zu schaffen. 🌍
Hier ein Fallbeispiel:
Paul ist ein 40-jähriger verheirateter Mann mit zwei Teenager-Kindern, der seit vielen Jahren mit einem Geheimnis lebt: Er sich danach, als Frau zu leben und authentisch sein wahres Selbst zu zeigen. Doch aus Angst vor Ablehnung und Unverständnis hat er diesen Wunsch bisher verheimlicht und verdrängt. Seine Ängste sind vielfältig. Er fürchtet sich davor, dass seine Familie ihn nicht akzeptieren könnte, dass seine Kinder verwirrt oder enttäuscht sein könnten und dass seine Ehe in Gefahr geraten könnte. Er macht sich Sorgen um sein berufliches und soziales Umfeld, um die Reaktionen seiner Freunde und Kollegen. Diese innere Unsicherheit und Angst begleiten ihn tagtäglich. Als Vater versucht er, ein gutes Vorbild zu sein und seine Kinder zu unterstützen, doch sein verstecktes Geheimnis belastet die familiäre Atmosphäre, die emotionalen Belastungen könnten sich auf die Kinder auswirken. In seiner Rolle als Vater fühlt sich Paul zerrissen zwischen seinen eigenen Bedürfnissen und Verpflichtungen. Er möchte seinen Kindern ein guter Vater sein, sie lieben und schützen, aber gleichzeitig auch als Frau leben. Paul trägt eine schwere Last auf seinen Schultern. Er weiß, dass der Weg zur Verwirklichung seines wahren Selbst steinig und schwierig sein wird.
Das Outing eines Elternteils als transsexuelle Person kann für Teenager eine komplexe und herausfordernde Erfahrung sein, die verschiedene psychologische Auswirkungen auf sie haben kann. Diese Auswirkungen können sich auf emotionaler, sozialer und kognitiver Ebene manifestieren:
Emotional: Gefühlen von Verwirrung, Unsicherheit, Angst, Wut oder Trauer . Eine neue Definition ihrer eigene Identität und Beziehung zum Vater als Mann steht im Vordergrund. Neu Studien zeigen, dass Teenager in solchen Situationen ein erhöhtes Risiko für psychische Gesundheitsprobleme wie Depressionen oder Angststörungen haben.
Sozial: Sie könnten mit Stigmatisierung, Vorurteilen oder Ablehnung durch ihr soziales Umfeld konfrontiert werden, insgesamt können das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der Teenager beeinträchtigen. Es kann zu einem Gefühl der Isolation oder des Andersseins führen, das die sozialen Beziehungen und das soziale Leben der Teenager beeinflusst.
Kognitiv: Die Teenager müssen möglicherweise ihre bisherigen Annahmen über Geschlecht und Identität überdenken und neu bewerten. Dieser Prozess kann zu Verwirrung, Unsicherheit oder Konflikten führen. Es erfordert eine Anpassung der internen Vorstellungen und Denkmuster der Teenager, um die neue Realität zu akzeptieren und zu verstehen.
Die gute Nachricht ist: Pauls Kinder (und ihre Mutter) haben in diesem Prozess Unterstützung von verschiedenen Stellen bekommen, was ihnen geholfen hat, ein neues und vor allem positives Bild über ihren Vater /Ehemann zu entwickeln und nun mit „Nelli“ wie selbstverständlich umzugehen. Es hat mehr als 2 Jahre gedauert, bis sich nach vielen Therapiestunden die Familie wieder stabilisiert hat (was leider oftmals nicht mehr möglich wird). Nun haben die Kinder 2 Mütter, von denen die eine im Herzen immer noch ihr alter Daddy ist, und die Ehefrau eine beste Freundin! Sie tauschen sogar ihre Klamotten .
Wo bekommt man Hilfen?
Hier sind einige Ressourcen und Organisationen, die Familien von transsexuellen Vätern bei der Bewältigung unterstützen können:
Transgender Network Switzerland (TGNS) – Eine Schweizer Organisation, die Informationen, Unterstützung und Ressourcen für transsexuelle Personen und ihre Familien anbietet.
Transgender Europe (TGEU) – Eine europäische Organisation, die sich für die Rechte von transsexuellen Personen einsetzt und Unterstützung für Familien von transsexuellen Vätern bietet.
TransFamily – Eine Online-Plattform für Familien von transsexuellen Personen, die Unterstützung, Informationen und Austauschmöglichkeiten bietet.
Regenbogenfamilien e.V. – Ein deutscher Verein, der sich für die Rechte von LGBTQ+ Familien einsetzt und Unterstützung für Familien von transsexuellen Vätern bietet.
Queer Leben – Eine Organisation in Österreich, die Beratung und Unterstützung für LGBTQ+ Personen und ihre Familien anbietet.
GLAAD – Eine internationale Organisation, die sich für die Darstellung und Akzeptanz von LGBTQ+ Personen in den Medien einsetzt und Ressourcen für Familien von transsexuellen Vätern bereitstellt.
Gender Diversity – Eine US-amerikanische Organisation, die Bildungsprogramme und Unterstützung für Familien von transsexuellen Personen anbietet.
Auch die AIDS-Hilfen und PRO FAMILIA bieten Beratungen an.
Diese Ressourcen und Organisationen können Familien dabei unterstützen, sich über Transsexualität zu informieren, Unterstützung zu finden und sich mit anderen Familien in ähnlichen Situationen auszutauschen. Es ist wichtig, dass Familien wissen, dass sie nicht alleine sind und dass es Unterstützung und Hilfe gibt, um einen solchen Prozess gemeinsam durchzugehen.
Sollte es DICH betreffen, habe den Mut, Hilfe in Anspruch zu nehmen!
Lasst uns Transfrauen feiern und ihre Geschichten hören und teilen. 📖 Habt ihr schon ein Buch über die Erfahrungen einer Transfrau gelesen?.
Danke, dass ihr euch für dieses wichtige Thema Zeit genommen habt. Lasst uns weiter gemeinsam wachsen und lernen. 🌈📚 Eure Stimme zählt! 💕
Wenn Du auch eine solche Veränderung bei Deinem Vater erlebt hast, erzähle mir gerne davon! Ich freue mich über Zuschriften und antworte garantiert und zeitnah!
Hab eine gute Woche und lass‘ Dich von Sonne bescheinen.
Bis zum nächsten Blog: „Transition- Der Transmann“
Bleib‘ mutig und stark!

Tschüssi
Dein Samuel
Themenreihe: "Die bunte Welt der Vielfalt" 1)Was wäre, wenn sich ein Vater als schwul bekennt? Allgemeines, Erfahrungsberichte, Unterstützungsangebote
10.03.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Freunde,
in meiner neuen Themenreihe möchte ich euch – auch denen, die nicht zur queeren Community gehören – einen wöchentlich abwechselnden Überblick über verschiedene Lebensentwürfe und ihrer möglichen „Begleiterscheinungen“ geben. Hier binde ich allseits bekannte, aber auch solche ein, über die in der Öffentlichkeit im Allgemeinen weniger gesprochen wird. In meinen Blogs tauchen wir kurz in die Welt der Vielfalt ein, um die Schönheit und Bedeutung unterschiedlicher Lebensweisen zu feiern, denn sie macht unsere Welt schöner und bunter. Vor allem ist mir wichtig, dass ich euch über Unterstützungsangebote informiere, die es für jeden gibt, der Anfangsschwierigkeiten damit hat, seine sexuelle Orientierung und Identität (oder die eines Freundes/einer Freundin/eines/einer Angehörigen) selbstsicher zu vertreten bzw. mit der (neuen) sexuellen Orientierung eines nahestehenden Menschen umzugehen.
Was wäre, wenn Du Dich oder Dein Vater Dich als als schwul bekennt?
Vorbemerkung:
Familienzusammenhalt in bunter Vielfalt:
Menschen sind wie Wörter in einem vielfältigen Buch – jede Seite erzählt eine einzigartige Geschichte. Und jeder hat ein Recht dazu zu sein, wer und wie er ist.
In einem bunten Kaleidoskop des Lebens spiegelt sich die Vielfalt wider, die uns umgibt. Neue Perspektiven und Erfahrungen entstehen, wenn wir offen sind für das Andersartige. Vielfalt bedeutet nicht nur Toleranz, sondern auch Bereicherung. Trotz unserer offenen Gesellschaft kommt es nach wie vor zu Ausgrenzungen und Diskriminierungen.
Was bedeutet Vielfalt?
Vielfalt bedeutet, dass Menschen unterschiedliche Lebensweisen und Ansichten haben. In einer Familie kann diese Vielfalt zu Fragen und Herausforderungen führen. Doch sie birgt auch die Chance, neue Perspektiven und Erfahrungen zu sammeln. Die Vielfalt innerhalb einer Familie sollte als Bereicherung betrachtet werden, die dazu beiträgt, ein harmonisches Miteinander zu schaffen. Akzeptanz und Unterstützung sind Schlüssel für den Familienzusammenhalt in all seiner Diversität. Es ist wichtig, dass jede Person in ihrer Einzigartigkeit respektiert wird.
1. Der Vater und sein innerer Konflikt: Das Coming-out
In den meisten Fällen, die mir begegnet sind, steht ein Vater vor einem gewaltigen inneren Konflikt, wenn er sich endlich dazu entschließt, sein Coming-out zu erleben. Bei der Offenbarung seines wahren Selbst spürt er eine Mischung aus Befreiung und Unsicherheit, und sie kann eine Vielzahl von Reaktionen hervorrufen, mit denen er nicht gerechnet hat. Die Angst vor Ablehnung durch die Ehefrau/Partnerin oder durch seine Kinder, egal in welchem Alter sie sind, und ihr Unverständnis lastet schwer auf seinen Schultern. Doch der Wunsch nach Authentizität und Wahrheit treibt ihn voran. Auch das soziale Umfeld kann in vielfältiger Weise auf ein Coming-out reagieren. Wie Menschen auf die Neuigkeiten reagieren, zeigt ihre Bereitschaft zur Offenheit und zur Anerkennung der Diversität in unserer Gesellschaft. Es ist in jedem Fall ein Wendepunkt im Leben der Familie, der sowohl Mut als auch Verletzlichkeit erfordert.
2. Kinder im Fokus:
Die Nachricht, dass ein Elternteil sich outet, kann für Kinder eine große emotionale Herausforderung darstellen. Sie können mit einer Vielzahl von Gefühlen konfrontiert sein, von Verwirrung und Unsicherheit, Distanzierung oder Aggressionen bis hin zu Angst und Sorge um die Reaktionen ihres sozialen Umfelds.
Im Fall meines Freundes Rainer verlief es jedoch positiv:
Sein Outing war ein mutiger Schritt, der von tiefer Liebe und Vertrauen geprägt war. In dem Moment, als er die Worte aussprach, fühlte er eine Last von seinen Schultern fallen. Die Reaktion seiner Kinder, beide im Teenager-Alter – war überwältigend positiv – sie umarmten ihn fest und versicherten ihm ihre bedingungslose Unterstützung. Ein warmes Lächeln, ein liebevoller Blick – die Erfahrung mit seinen Kindern auf sein Outing war einfach wundervoll und für ihn unerwartet. Sie zeigten nicht nur Vertrauen, sondern auch uneingeschränkte Akzeptanz.
Was seine Geschichte uns zeigt: Diese Erfahrung zeigte deutlich, wie stark Vertrauen in Familienbeziehungen ist und wie es durch Offenheit und Ehrlichkeit gestärkt werden kann. Rainers Entscheidung, sich zu öffnen, schuf eine neue Ebene des Vertrauens zwischen ihnen und legte den Grundstein für eine noch liebevollere und unterstützende Beziehung.
3. Fazit: Liebe, Verständnis und Zusammenhalt – Eine bunte Familie voller Vielfalt
In einer Welt voller Vielfalt und unterschiedlicher Lebensweisen bedeutet Familienzusammenhalt mehr als je zuvor. Die Akzeptanz und Unterstützung innerhalb einer Familie können das Leben von LGBTQ+ Personen maßgeblich beeinflussen. Ein harmonisches Miteinander, geprägt von Liebe und Verständnis, ist der Schlüssel zu einem glücklichen Zusammenleben. Eine bunte Familie, die Vielfalt in all ihren Facetten umarmt, kann neue Perspektiven eröffnen und bereichernde Erfahrungen ermöglichen. Denn letztendlich liegt die wahre Stärke einer Familie in ihrer Fähigkeit, trotz aller Unterschiede zusammenzuhalten und sich bedingungslos zu lieben.
4. Hilfen
Es kann für die Kinder in der Schule, im Sportverein oder sonstigen sozialen Verbänden, in den Kirchen, aber auch durch Freund*innen zu Mobbing und Diskriminierung kommen, was unter Umständen einer psychologischen Unterstützung bedarf oder den Besuch einer Beratungsstelle erfordert.
In Nordrhein-Westfalen gibt es für LGBTIQ* und ihre Angehörigen 6 vom Land geförderte Beratungsstellen (in Bochum, Dortmund, Köln, Münster, Siegen und eine mobile Beratung im Raum Niederrhein/westliches Ruhrgebiet). Auch kirchliche Stellen, wie z.B. von der Caritas und der Diakonie, bieten ihre Dienste dafür an. Die Kontaktdaten für die geförderten Beratungsstellen findet ihr auf der Internetseite des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.
Das bundesweite Jugendnetzwerk Lambda e. V. bietet unter www.comingout.de eine Beratung von Jugendlichen für Jugendliche und deren Angehörige an.
In Berlin (wie auch in anderen Ballungsräumen) sind außerdem möglich:
- Deutscher Kinderschutzbund: 030 45 80 29 31
- Kinderschutzzentrum Berlin: 030 683 91 10
- Nummer gegen Kummer: – Kinder– und Jugendtelefon: 116 111
- Jugendnotmail.Berlin.
- bke-Jugendberatung.de.
Seit 1991 aktiv, ist der Väteraufbruch für Kinder Berlin-Brandenburg e.V. die für beide Bundesländer zuständige Regionalorganisation des bundesweit tätigen Vereins Väteraufbruch für Kinder e.V.. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der ehrenamtlichen Beratung betroffener Väter und Mütter
Einen bundesweiten Beratungsstellenfinder stellt das Portal www.liebesleben.de bereit. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bietet unter www.antidiskriminierungsstelle.de eine kostenlose Beratung an.
Weitere informative und hilfreiche Links:
Hast Du Erlebnisse in Bezug auf das Thema? Dann teile mir gerne Deine Gedanken dazu im Kontaktformular mit oder schreibe mir per E-Mail an coenigsbergsamuel.berlin@gmail.com.
Ich freue mich über Zuschriften und antworte garantiert und zeitnah!
Hab eine gute Woche und lass‘ Dich inspirieren.
Bis zum nächsten Blog „Transgender“

Tschüssi
Dein Samuel
Letzte Ergänzungen zum Autorendasein und Blog: Einsamkeit älterer Menschen der LGBTQ+- Community
04.03.2024 – Samuel Coenigsberg
Liebe Freunde,
Zunächst: Wie ihr im letzten Blog gelesen hattet, gehört viel dazu, bis man als (queerer) Autor erfolgreich sein kann. Da ich ja kein Autorencoach- oder Berater bin (das können andere professionelle viel besser als ich und soll auch nicht mein Job sein!) und ich euch als mein Publikum mit Themen begeistern will, die euer Interesse im Genre „Queeres Leben/Biografien, Queer Romance/Entwicklungsroman“ abholen , hier als letzte Ergänzung noch eine kurze abschließende Auflistung dessen, mit welchen alltäglichen und weiteren Tätigkeiten ich noch beschäftigt bin:
- Social Medias mit Content-Posts versorgen;
- Regelmäßig interessante Newsletter mit abwechslungsreichen und informativen Beiträgen schreiben (habt ihr ihn schon abonniert?);
- Lokale und überregionale Zeitungsartikel verfassen/Interviews anbieten;
- Radiosender in meine Arbeit einbinden;
- Lesungen bewerben, terminieren und halten;
- Messe-Besuche, wie z.B. die kommende in Leipzig und die BuchBerlin
- Leser-Briefe/-Emails beantworten u.v.m.
Nun zum heutigen Thema, das mir persönlich am Herzen liegt:
Einsamkeit bei queeren älteren Menschen – eine gesellschaftliche Herausforderung
Der Frühling steht in den Startlöchern, viele Menschen genießen ihn gemeinsam und planen bereits, zu ihrer Familie über die Feiertage zu fahren oder sie anderweitig in Gesellschaft zu verbringen. Allerdings hat nicht jeder diese Familie, Partner*innen oder Freund*innen, die beispielsweise zu Ostern für ein gemütliches Beisammensein zur Verfügung stehen. Vor allem queere Personen sind besonders oft von Einsamkeit betroffen. Dies kann im Kontrast zu all den glücklich und viel beschäftigt wirkenden Leuten besonders bedrückende Gefühle hervorrufen.
Aus der Literatur und der empirischen Forschung hat sich laut Statistik des Bundesgesundheits-ministeriums ergeben, dass ein relevanter Teil der LGBTQI+-Personen, die heute im Pensionsalter sind, ein Interesse an einem Zusammenleben mit anderen queeren Menschen im Alter hat, nicht nur, um Einsamkeit zu entgehen.
Grundsätzlich sieht sich die LGBTQ+ -Community, geprägt von gesellschaftlicher Stigmatisierung und Diskriminierung, oft mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Satte 15 Prozent der Menschen aus der Community gaben gegenüber dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung an, sich häufig einsam zu fühlen. Bei transidenten Menschen waren es sogar jede*r Dritte. Warum?
Ältere queere Menschen können sich aufgrund fehlender Unterstützungssysteme, isolierender Lebensumstände und dem Verlust von Freunden und Partner*innen zunehmend alleine fühlen. Ein großes Problem sind nicht vorhandene familiäre Bindungen, viele sind Single und haben auch zur Herkunftsfamilie keinen Kontakt mehr. Zudem sind Armut und Altersarmut überdurchschnittlich hoch. Nicht zuletzt: Insgesamt wird die Partnersuche nicht leichter: Mit zunehmendem Alter wird die Szene leider immer gleichgültiger und hartherziger. Dort geht es überwiegend um Jugendlichkeit, Sportlichkeit, mithalten können und Schönheit. Das grenzt Ältere unter uns natürlich in der Regel eher aus, ich kenne das aus eigenen Erfahrungen.
Einsamkeit unter schwulen Männern, insbesondere bei älteren, ist ein besonders ernstzunehmendes Thema, das mit verschiedenen Risiken verbunden ist. Wer sich zunächst als schwuler Mann outet und dann noch einmal als HIV-Positiver, riskiert in traditionellen Familienverbünden eine Menge. Laut Studien haben es Lesben einfacher, wiederum nicht übrige diversgeschlechtliche Personen.
Ich, der ich selber im Gesundheitswesen tätig bin, halte es für unabdingbar, dass die Community und Gesundheitseinrichtungen Maßnahmen ergreifen, um diese Einsamkeit zu bekämpfen! Mögliche Lösungen könnten die Schaffung von spezifischen Unterstützungsgruppen, die Förderung von sozialen Aktivitäten und die Sensibilisierung für das Thema Einsamkeit in der LGBTQ+ -Community sein. Darüber hinaus können professionelle Beratungsangebote und psychologische Unterstützung einen entscheidenden Beitrag leisten.
Ich halte es für entscheidend, dass wir als Gesellschaft die Bedeutung von sozialer Verbundenheit und Unterstützung der LGBTQ+ -Personen, insbesondere ältere, erkennen und entsprechende Möglichkeiten ergreifen, um Einsamkeit zu reduzieren und das Wohlbefinden dieser Menschen zu fördern.
Was kannst Du als Betroffener tun? Hier ein paar Vorschläge:
- Über den Freundeskreis oder Social Media die Initiative ergreifen und aktiv fragen, ob jemand etwas gemeinsam mit dir unternehmen möchte. Vielleicht findet sich so jemand, der auch einsam ist, und ihr tut euch zusammen?
- Nimm ein Ehrenamt an, das Dir Spaß macht und Abwechslung bringt (in Ehrenamtsbörse Deiner Stadt recherchieren)
- Dir ein Haustier anschaffen. Dies wird tatsächlich häufig als helfend geraten, wenn es um Einsamkeit und deren Bewältigung geht.
- Mach einen Sprachkurs (z.B. an der VHS o.a.).
- Informiere Dich, welche queeren Veranstaltungen es möglicherweise in Deiner Nähe gibt (z.B. Besuch eines queeren Cafés, das auch Programm anbietet, wie beispielsweise in Berlin „Ullrichs Café); die örtlichen Aidshilfen aufsuchen, die mit Rat und Tat und auch Festivitäten und weiteren Events den Alltag herausputzen. Oder beteilige Dich an einer Stadtführung durch die Geschichte der Sexualität. Für diejenigen aus NRW empfehle ich “Altern unterm Regenbogen” in Düsseldorf, die sich um Menschen im LGBTIQ-Spektrum ab 55 kümmert, viele von ihnen leiden auch unter Einsamkeit.
- Sich einem Verein anschließen (Literatur, Natur, Bildung,..)
- Wichtig: Finde jemanden der Dir zuhört. Im Ernstfall über Notfallnummern, Chats oder Dienste vor Ort.
- Professionelle Dienste, bei denen Du Dich ruhig trauen kannst, sie in Anspruch zu nehmen, sind unter 9. aufgeführt.
- Verlasse Dich drauf: Hier sind kein Kummer und keine Träne zu viel!!
- – Sozialpsychiatrischer Dienst Deiner Stadt, sieh:
- – Regenbogenchat des Queer Lexikons (zusätzliche Zeiten über die verschiedenen Feiertage)
- – Krisendienst – Krisenchat
Dir fallen bestimmt noch weitere Optionen ein. Schreibe mir sie gerne, ich veröffentliche sie dann im nächsten Blog. Vielleicht hast Du auch einen Buchtipp?
In der nächste Blogreihe erwartet Dich:
„Die bunte Welt der Vielfalt“
Allgemeines, Erfahrungsberichte, Unterstützungsangebote
Blog 1: Was wäre, wenn sich ein Vater als schwul bekennt?
Schreib mir gerne, wenn Du Ideen oder Fragen hast und nutze entweder auf der Homepage unter Kontakt das Kontaktformular oder schreibe mir per E-Mail an coenigsbergsamuel.berlin@gmail.com. Ich freue mich über Zuschriften und antworte garantiert und zeitnah!
Hab eine gute Woche und genieße die Frühlingsvorboten, am besten nicht allein!
Bis zum nächsten Blog

Tschüssi
Dein Samuel
Wie ich meinen Traum weiter verfolgte, Autor zu werden
24.02.2024 – Samuel Coenigsberg
Wieder mal ist es Sonntag, wie schön, dass ihr wieder hier seid!
Nun, wie ich euchschon im letzten Blog geschildert hatte, musste ich im Laufe der Zeit so Einiges dazulernen. Normalerweise bin ich im Job ein ruhiger und achtsamer Mensch. Nur im Privatleben ist zu meinem Nachteil meine innewohnende Ungeduld mein größter Feind.
Hier im Einzelnen von meinen weiteren Schritten, die ich machte:
Schreibzeiten: Ich musste mir hart erarbeiten, mir für das Schreiben eines Buches die nötige Zeit einzuräumen. Das tat ich, indem ich mir Schreibzeiten festlegte, die in meinen Wochen- und Tagesablauf als Vollzeitkraft passten. Das genügte aber nicht, denn ich neigte dazu, in diesen Zeiträumen stundenlang am Stück zu schreiben und war anschließend total erschöpft, und manches Mal war es am Folgetag notwendig, das Geschriebene wieder zu löschen oder zumindest gründlich zu überarbeiten, weil es entweder voller Fehler oder gar ohne Sinn und Verstand war, was mich jedes Mal frustrierte. Also musste ich mir etwas überlegen.
Schreibmethode wählen: Von Sandra hörte ich eine großartige Idee: „Schreibe nach der Pomodore-Methode“, sagte sie zu mir. Davon hatte ich noch nie gehört. Was hat eine Tomate mit Schreiben zu tun?“, fragte ich sie. Hier die Erklärung:
Die Pomodoro-Technik ist eine bewährte Methode, um die Arbeitsproduktivität zu steigern und gleichzeitig geplante Pausen für Erholung und Regeneration einzubauen. Basierend auf 25-minütigen Arbeitsabschnitten (Pomodori), gefolgt von kurzen Pausen.
Das Ziel ist: Eine maximale Konzentration in kurzen, intensiven Arbeitseinheiten zu erreichen und zu festigen.
Ablauf: Wähle eine Aufgabe aus, die erledigt werden soll. Stelle einen Timer auf 25 Minuten ein (ein Pomodoro).
Arbeite ununterbrochen an der Aufgabe, bis der Timer abläuft. Nach jedem Pomodoro folgt eine kurze Pause (ca. 5 Minuten)
Nach 4 Pomodori eine längere Pause einlegen (ca. 15-30 Minuten). Hier kann man sich etwas erholen, indem man beispielsweise eine Runde um den Block geht, einen frischen Tee aufbrüht, Gymnastik macht oder eine Achtsamkeitsübung.
Und das Besondere ist: Eine Wiederholung dieses Zyklus hilft, Fokus und Effizienz zu steigern. Sie unterstützt die Vermeidung von Ablenkungen und Überlastung. Diese Methode ist flexibel anpassbar an individuelle Arbeitsweisen und Bedürfnisse.
Das war die Lösung! Folglich übte ich mich ein und stellte fest, dass ich wesentlich effektiver und weniger erschöpft arbeiten konnte. Diese Schreibtechnik wende ich heute noch an, nur selten falle ich in mein altes Muster, meistens dann, wenn die Inspirationen und Gedanken beim Schreiben überhand nehmen und mit enrgischer Begeisterung aus meinem Kopf und dem Herzen regelrecht herausdrängen wollen.
Schreibprogramm: Ich war es bis dato gewohnt, MS-Word für alles Schriftliche zu benutzen. Bis ich erfuhr, dass es für Autoren spezielle Schreibprogramme gibt, die einerseits die Arbeit erleichtern, andererseits unglaublich viele anschauliche und hilfreiche Tools besitzen, die beim Schreiben unterstützen können hinsichtlich Stilanalyse, Erstellen von Charakterkarten, Auftreten von Wortwiederholungen, Hinweise auf Synonyme und Satzlängen u.v.m.. Also griff ich in den Geldbeutel und erstand eines der führenden Programme, mit dem ich bis heute sehr glücklich bin, weil es mir so einiges abnimmt und mich von sich aus zu einer Textverbesserung auffordert. Natürlich sei jedem Autor unbenommen, seine Arbeiten per Word-Dokument zu verfassen, doch man kann aufgrund der genannten Vorzüge wesentlich gewinnbringender arbeiten.
Recherche: Als Autor ist es mir ungemein wichtig, dass ich meine Leser*innen nicht nur spannend unterhalte, sondern auch über kulturelle, geografische und gesellschaftspolitische Hintergründe der Akteure schreibe, um ein dichtes Bild zu erzeugen. Daher verwende ich stets mindestens ein Drittel damit, mich umfänglich in Fachliteratur und Artikeln zu informieren und davon das entsprechend dem Roman Dienliche zusammenzutragen. Das erfordert nicht nur viel Zeit, sondern auch ein Gefühl dafür, was meiner Geschichte zuträglich ist. In der „Que(E)rflug“-Dilogie habe ich mich ausführlich mit Biologie, Geografie, Völkerkunde, Medizin, Theologie und Philosophie beschäftigt und dazu noch Interviews von Insidern eingeholt. Anschließend habe ich entschieden, was und wieviel ich davon ins Buch einfließen lassen möchte, unter der Prämisse, der Leserschaft nicht das Gefühl zu vermitteln, sie belehren zu wollen oder mit Informationen zu langweilen. Vereinzelt nehme ich tatsächlich auch die Möglichkeiten der KI in Anspruch und prüfe sie eingehend, bevor ich von ihr etwas übernehme.
Korrektorat / Lektorat / Buchsatz / Literaturverzeichnis: Zugegeben: Beim ersten Buch habe ich mir ein professionelles Korrektorat und Lektorat erspart, weil meine langjährige Redaktionsassitentin, A. Poth, eine gut gebildete, verlagserfahrene und überaus gewissenhafte und sorgsame Kraft ist. Sie hat unzählige Male meine Dateien überarbeitet und mit einer ungeheuerlichen Geduld mein Geschreibsel korrigiert und teils lektoriert bis hin zum Erstellen des Buchsatzes, des Literaturverzeichnisses und der Vorbereitung der Veröffentlichung. Für diesen Prozess gingen noch ein paar Monate ins Land. Erst später, nämlich bei der Veröffentlichung von Band II, beauftragte ich eine professonelle Lektorin (Dorrit Bartel), die für mich ein „Korrektorat+“ machte, also ein Korrektorat mit einem Anteil von Lektorat. So konnte ich mich auf die Richtigkeit der Orthographie und Semantik verlassen und war dankbar für Impulse hinsichtlich der Logik und des Aufbaus meiner Geschichten. Das Ganze kostete abermals eine Stange Geld, aber das war es mir wert. In der Zwischenzeit erledigte ich noch Weiteres:
Titelschutz / Markenschutz / Lizenzen: Damit mein Buchtitel gesichert ist, den sich zufällig mehrere Autoren gleichzeitig für ihr Werk aussuchen könnten, habe ich auf Anraten von A. Poth für beide Bücher einen Titelschutz beantragt, nicht besonders teuer, aber äußerst wirksam, denn so konnte ich mir (für einen übersichtlichen Zeitraum bis zur Veröffentlichung) meinen mit Bedacht überlegten Buchtitel schützen. Ich glaubte zwar, dass „Que(E)rflug“ wahrscheinlich ein einzigartiger Titel wäre, auf den sonst kein anderer Autor (oder Verlag) kommen sollte, aber man weiß ja nie! Ebenso verhielt es sich mit meiner Marke, dem Nachtfalter mit meiner Signatur. Das Bild des queeren Schmetterlings hat ein Freund meiner Kinder entworfen (sein Original hängt im Großformat in meinem Arbeitszimmer), und ich wollte, dass dieses Kunstwerk allein in meiner Hand bleibt und von niemandem abgekupfert werden kann. Also fügte ich meine Signatur hinzu und reichte es beim Patentamt ein. Nach kurzer Zeit erhielt ich eine entsprechende Urkunde, worauf ich ein wenig stolz bin.
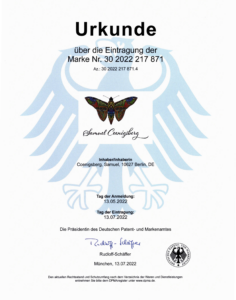 Außerdem hatte ich am Anfang nicht bedacht, wie sehr Lizenzen für Zitate, Songtexte, Auszüge aus Fachliteratur oder Belletristik, selbst Bibeln, unerlässlich sind. Daher schrieb ich alle möglichen Autoren, Musikverlage, Herausgeber von Fachliteratur und sonstiger Literatur bis ins Ausland an und bat darum, mir eine Genehmigung für den Abdruck zu erteilen. Dafür musste ich seitenweise Anträge ausfüllen und Nachweise erbringen. Bis auf einen Herausgeber gaben mir alle eine Lizenz, sodass ich beruhigt und ohne eine Konventionalstrafe zu riskieren, die gewünschten Beiträge an passender Stelle abdrucken konnte. Natürlich kosteten die Lizenzen etwas, aber es hielt sich in Grenzen. Für meinen neuen Roman, der erst zum Jahreswechsel erscheinen wird, muss ich mich schon jetzt um entsprechende neue Lizenzen kümmern, damit diese rechtzeitig ausgestellt werden.
Außerdem hatte ich am Anfang nicht bedacht, wie sehr Lizenzen für Zitate, Songtexte, Auszüge aus Fachliteratur oder Belletristik, selbst Bibeln, unerlässlich sind. Daher schrieb ich alle möglichen Autoren, Musikverlage, Herausgeber von Fachliteratur und sonstiger Literatur bis ins Ausland an und bat darum, mir eine Genehmigung für den Abdruck zu erteilen. Dafür musste ich seitenweise Anträge ausfüllen und Nachweise erbringen. Bis auf einen Herausgeber gaben mir alle eine Lizenz, sodass ich beruhigt und ohne eine Konventionalstrafe zu riskieren, die gewünschten Beiträge an passender Stelle abdrucken konnte. Natürlich kosteten die Lizenzen etwas, aber es hielt sich in Grenzen. Für meinen neuen Roman, der erst zum Jahreswechsel erscheinen wird, muss ich mich schon jetzt um entsprechende neue Lizenzen kümmern, damit diese rechtzeitig ausgestellt werden.
Illustration: Ansprechende und aussagekräftige Bilder sind für mich ein bedeutender Anteil in meinen Büchern. Sie sollen die Leserschaft visuell ins Geschehen eintauchen lassen können und atmosphärisch eine Dichte herstellen, zusätzlich zu meinen mit großer Sorgfalt ausgesuchten Beschreibungen. Dazu konnte ich im ersten Band meiner Dilogie denselben Künstler (Joel Burbach) gewinnen, der mir den Nachtfalter entworfen hatte und auf Zuruf passende Zeichnungen für die Kapitelüberschriften anfertigte. Für Band II beauftragte ich die Schwester eines Kollegen (Beeke Steingrüber), die von sich sagte, sie könne „einigermaßen gut“ zeichnen, habe aber noch nie eine Auftragsarbeit gemacht. Von wegen! Sie erstellte mit ihrer sagenhaften Begabung erstaunliche Zeichnungen, die wie geschaffen für das Buch sind. Mit diesem Feedback hatte sie gar nicht gerechnet, aber so viel: Sie studiert mittlerweile Grafikdesign, angestachelt durch Verwendung ihrer Zeichnungen (Z) „sogar in einem veröffentlichten Buch“ und ihrer Liebe zur Gestaltung und zum Design. Ich bin sicher, dass aus ihr noch etwas ganz Großes wird!
Coverdesign: Eine der schwersten Übungen! Ihr werdet es vielleicht schon beobachtet haben: Mittlerweile sind meine Bücher ein zewites Mal mit unterschiedlichen Covern versehen. Das hat folgenden Hintergrund: Bei Band I hatten meine Kinder für ein durchaus ansprechendes Cover gesorgt, doch ich erhielt von Autoren-Kolleg*innen den Hinweis, dass man mit geschultem Auge sehen könne, dass es nicht von einem professionellen Designerdienst erstellt worden sei und dass es demzufolge vermutlich den Erfolg behindere. Also engagierte ich eine gewerbsmäßig erfahrene Fachfrau, sich diesem anzunehmen und gleichzeitig für den zu veröffentlichenden Band II aufeinander abgestimmte Cover zu erstellen. Mit den Ergebnissen war ich zwar sehr zufrieden, denn sie erstellte ganz wunderschöne Cover mit beeindruckenden Motiven, inspiriert durch meine eigenen Vorstellungen. Jedermann fand diese Cover sehr schön, doch auch hier war ein Wehmutstropfen: Beide erweckten den auf sie aufmerksam gewordenen Interessenten den spontanen Eindruck, es handele sich um esoterisch bzw. spirituell gelagerte Literatur. Und als sie dann der Wahrheit förmlich ins Auge sahen, stellten sie fest, dass ihre Einschätzungen falsch waren, weil die Cover nicht zum Genre (queere Literatur) und dem Inhalt passten (romanhafte Biografie).
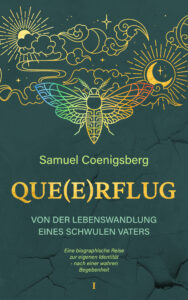
Daher wurden die Bücher zwar aus dem Bücherregal entnommen, aber danach gleich wieder hineingestellt und nicht gekauft! Durch Janet Zentel vom Bookerfly-Club wurde ich damenswerter Weise motiviert, beiden Büchern nochmals ein neues Kleid zu verpassen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mehr Verkäufe zu erzielen. Und so begab ich mich erneut auf Suche nach einer passenden Cover-Designerin.
Auf Empfehlung von Kolleg*innen fand ich in der presigekrönten Designerin Laura Newman, die ein Inbegriff für tolle Cover unterschiedlichster Genres ist, meine neue Gestalterin für meine Bücher. Sie krempelte beide Vorlagen komplett um und designte schlichte und zielgruppenorientierte, aussagekräftige Cover, die nun seit Sommer letzten Jahres das Licht der Welt im Handel erblickten.
Bisher bekam ich nur Zuspruch und habe mehr Erfolg bei den Verkäufen als zuvor.
Also habe ich alles richtig gemacht, und auch Laura sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank gesagt für ihre tolle Arbeit, wir werden nun zeitlebens zusammenarbeiten!;)
Impressumservice: In Deutschland ist man als Autor verpflichtet, eine Impressumservice-Adresse auf allen Kanälen (Homepage, soziale Medien, in den Büchern etc.) anzugeben. Der Grund: Der Autor soll in seiner Privatsphäre geschützt bleiben. Kaum vorzustellen, dass plötzlich ein Fan vor meiner Haustüre steht, der mir etwa Nussschokolade bringen will und Zugang in mein privates Reich möchte. Es könnte aber auch jemand sein, den beispielsweise etwas aus meinen Büchern so gar nicht gefällt und mich daher persönlich gegenüberstehend angreifen, verletzen oder gar töten will, man weiß ja auch hier nie. Der Schutz meiner Familie und meiner Person geht immer vor! Mittlerweile habe ich einen dritten Impressumservice (Impressumservice Bookerfly-Club) beauftragt, der ab jetzt und womöglich dauerhaft der Adressat bleiben wird. An dieser Stelle herzlichen Dank ans Bookerfly-Team!
Distributor vs. Verlag: Als Autor*in träumt man davon, dass das eigene Manuskript über einen Agenten bei einem Verlag „der Glückseligkeit“ Anklang findet, nachdem es aus den tausenden Zusendungen aus dem Stapel herausgezogen und für gut befunden wurde und man dort unter einen Vertrag gestellt wird, der mir die Zukunft sichert und meine Bücher in den Handel bringt. Wenn das so passiert, wunderbar! Dennoch ist – je nach Vertragsgestaltung – zu bedenken, dass man schlechtestenfalls als Autor nicht mehr alles in der Hand hat und in bestimmter Weise fremdbestimmt wird. Dies trifft zum Beispiel auf das Design des Covers zu, auch obliegt es den im Verlag tätigen Lektoren, gewisse Inhalte, ja möglicherweise ganze Kapitel herauszustreichen oder sogar einen anderen Titel als den, den ich mir ausgedacht habe, für das Buch zu verwenden. Dementgegen habe ich weniger Arbeit, weil viele Leistungen vom Verlag übernommen werden, um die ich mich sonst selber kümmern müsste. Eines aber bleibt immer gegeben: Um das Marketing muss ich mich selber bemühen, da dafür die Verlage zu wenig Kapazitäten haben. Wenn man einmal unter Vertrag steht, erwartet dieser, dass man innerhalb eines vorgegebene Zeitrahmens soundsoviele Veröffentlichungen zu einem fest angesetzten Termin hinbekommt. Das kann je nach Persönlichkeit Druck erzeugen, andere widerum beflügelt es in ihrer Kreativität. Zugegeben: Ich hatte auch davon geträumt, aber die Wirklichkeit als kleiner und unbekannter Autor mit einem Nischenprodukt und dann noch vollzeitberufstätig, hatte mich eines Besseren belehrt. Also entschied ich nach mehrfachen Versuchen, in einem Verlag unterzukommen, als Selfpublisher zu veröffentlichen. Dazu recherchierte meine Redaktion ausgiebig sämtliche Anbieter auf dem Markt, verglich Service, die Komplexizität beim Hochladen der Dateien, Bereitstellung im Vertrieb, Schnelligkeit in Druck und Versand bei book on demand-Bestellungen durch den Handel, Druckqualität, Rabatte bei eigenen Bestellungen, Verkaufserlöse, Messeauftritt usw.. Die Anzahl der Anbieter ist in Deutschland immens hoch. Am Ende entschieden wir uns für den, der noch heute die Prints herausgibt (Epubli), die E-Books haben inzwischen ins Amazon KDP-Select gewechselt, weil ich mir hier mehr Reichweite und Umsätze verspreche, wir werden sehen. Sicher, es ist so, dass ich nach wie vor selber für alle oben erwähnten Leistungen vor einer Veröffentlichung selber Sorge tragen muss, was auch müßig sein kann, doch dafür bin ich frei in der Gestaltung und kann unter größtmöglicher Selbstbestimmung meine Bücher so veröffentlichen, wann und wie ich es für richtig halte. Jeder darf da für sich selbst nach seinen Prioritäten entscheiden, ich jedenfalls werde vorerst beim Selfpublishing bleiben.
Community: Von Anfang an hat mir ein Kontakt zu Gleichgesinnten, also zu Autor*innen gefehlt, um mich mit ihnen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen, auch wenn es durch Kritik erfolgen sollte. Ich fühlte mich lange Zeit allein auf weiter Flur. Bis ich eines Tages durch eine Werbung auf den Bookerfly-Club mit Janet Zentel + Team gestoßen bin. Welch ein Segen! Hier finden sich Autor*innen zusammen, die das Gleiche eint: Mit dem Herzen leidenschaftlich schreiben, sich der Welt mitteilen und Leser*innen damit zu erfreuen oder zu informieren. Ich bin nun schon längere Zeit im Bookerfly-Club Mitglied und unfassbar dankbar für so viel Unterstützung, die mir widerfährt oder die ich geben darf. Ich habe nicht mehr das Gefühl allein, sondern Teil einer solidarischen Gemeinschaft zu sein, ohne Neid oder Konkurrenzkraft und mit Fachleuten, die mich mit Lektorat und Vorbereitungen zum Release begleiten können. Überrascht war ich von den vielen Angeboten, die der Club bietet (Ausbildungen, Kurse unterschiedlichster Art, persönlicher Austausch mit dem Team, Unterstützung bei jedem Schritt, ja sogar ein 1x/Jahr stattfindender Kongress). Somit entschloss ich mich, einen Magie-Buchmarketingkurs zu besuchen, einen Instagram-Kurs zu buchen und zuletzt einen Frauenpower-KI-Kurs zu belegen. Klar, kostet alles jeweils Kohle, ist aber keineswegs rausgeschmissenes Geld, sondern eine sinnvolle und hilfreiche Inverstition in meine Zukunft als Autor. Innerhalb dieser Kurse-Community profitiere ich von regelmäßigen Zooms, es gibt aber auch hier Regionalgruppen oder Kursmitglieder, mit denen ich mich zuweilen treffe (meine „BuMaKu-Girls“). Darüber bin ich sehr froh und danke an dieser Stelle allen Beteiligten des Bokkerfly-Teams! Bis zum nächsten Treffen auf der Leipziger Buchmesse! Als weitere Community bin ich dem Deutschen Selfpublisher-Verlag beigetreten, der meine Rechte als Autor*in vertritt und auch sonst viele hilfreiche Dinge anbietet sowie Öffentlichkeitsarbeit leistet. Außerdem ist er auf allen Buchmessen vertreten und bietet dort meine Bücher an, ja sogar auf der kommenden Leipziger Buchmesse werde ich ein „Meet and Great“ an deren Stand machen dürfen, worauf ich schon sehr gespannt bin (Info folgt in den Social Medias).
Für heute zuletzt: Homepage
Wie ihr wisst: Ich bin ein technisch unbegabter und digitaler Neandertaler, wie ich schon an anderer Stelle zugab. Zu „meiner Zeit“ gab es nicht mal Handys, Computer und geschweige ein Internet zu nutzen.Heute kann ich mit großer Dankbarkeit berichten, dass es meinem versierten und begabten Sohn in langer und mühevoller Arbeit gelungen ist, eine professionelle Homepage für mich zu bauen. Wenn ihr sie euch hier anseht, findet ihr ein wunderbares Design mit allen möglichen grafischen Besonderheiten, mit denen er die Seite übersichtlich und eindrücklich gestaltet hat. Jedes Mal, wenn ich eine neue Idee (kommt häufiger vor!) oder einen neuen Beitrag oder eine Verbesserung in die jeweiligen Buttons eingebunden haben möchte, nimmt er sich dieser selbstverständlich an und tut seinem lästigen Vater den Gefallen, dem so schnell wie möglich nachzukommen. Es bedarf tatsächlich immer wieder Anpassungen, sei es, wenn ein neues Interview oder Aktuelles eingepflegt werden muss oder aber – seit Neuestem – ein neuer Button „Blog“ erstellt werden muss. Dies macht er unabhängig davon, wo er sich gerade auf diesem Globus befindet (er ist zurzeit ein Weltenbummler). Diese Kreativität und den Spürsinn dafür hat er keinesfalls von seinem Daddy, obwohl wir uns in unserem Wesen ansonsten recht ähnlich sind. Meine liebe Tochter, ebenfalls häufig unterwegs, unterstützt mich dagegen in anderen Dingen, aber davon und von vielem mehr erzähle ich euch gerne im nächsten Blog… .
Schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt und nutzt entweder unter Konatkt ins Kontaktformular oder per E-Mail an coenigsbergsamuel.berlin@gmail.com, ich freue mich über Zuschriften und antworte garantiert und zeitnah!
Habt eine gute Woche voller Sonne im Herzen und Gottes Segen.
Bis zum nächsten Sonntag.
 Euer Samuel
Euer Samuel
Der Beginn, meinen Traum als Autor zu verwirklichen
17.02.2024 – Samuel Coenigsberg
Wer hat nicht als jemand, der gerne seine Gedanken verschriftlicht und zudem eine Leseratte ist, den Traum, eines Tages etwas, das ihn begeistert oder bewegt, so zu Papier zu bringen, dass es veröffentlicht wird und in den Regalen der Buchhandlungen oder als E-Book vorzufinden ist und damit unterschiedlichste Menschen begeistert, bewegt, unterhält, lehrt oder informiert? Völlig unabhängig davon, um welches Genre es sich handelt: Krimis, Liebesromane, Thriller, Fachbücher, Kochbücher, Ratgeber für alles Mögliche, Kinderbücher, Entwicklungsromane, Biografien und so weiter.
Mir ging es schon zu Schulzeiten so, dass ich immer sehr gerne Aufsätze aller Art schrieb, allerdings fiel den Lehrer*innen und Schüler*innen schon früh auf, dass meine Beiträge (außer in meinem damaligen Horrorfach Mathematik) stets ziemlich ausführlich und lang waren und ich eine Begabung zu haben schien, Dinge mit einer gewissen atmosphärischen Dichte zu beschreiben. Manche lachten mich dafür aus, andere widerum schrieben in Klausuren bei mir ab. Noch aber steckte mein Talent zur Schriftstellerei in den Kinderschuhen, denn das alleine sollte noch lange nicht genügen.
Im Studium (Theologie und Philosophie) musste ich mich allerdings auf das Wesentliche konzentrieren, und hier hatten poetisch anmutende Texte oder langatmige Charakterisierungen, Schilderungen und Erläuterungen nichts zu suchen, denn auf Treffsicherheit und klare Akzentuierung sowie ergebnisorientierte Lösungsansätze der jeweiligen wissenschaftlichen Themen kam es an, auf nichts anderes. Das langweilte mich und war keineswegs meine Leidenschaft, ich vermisste es, mit ausgewählten Worten, Metaphern und Esprit DAS LEBEN zu beschreiben statt überflüssiges, bereits allseits bekanntes, theoretisches „Gelabere“, das schon tausende Male vorher in unzähligen Versionen verfasst worden war. Ich wollte etwas Eigenes, Unverwechselbares schreiben dürfen mit Mehrwert für Menschen aller Couleurs.
In meiner späteren beruflichen Ausbildung musste ich mich ähnlich dazu zwingen, punktgenaue Ergebnisse abzuliefern. Alles verlief also einseitig fremdbestimmt ohne die Möglichkeit zu haben, seinen eigenen Schreibstil- oder Charakter anwenden zu dürfen.
Eines Tages, viele Jahre später, begegnete ich im Rahmen meiner Arbeit einem ganz besonderen Menschen, in dessen Biografie ich mich teilweise wiederfand: Er war ebenso wie ich ein schwuler Vater mit Migrationshintergrund und hatte eine Trennungsgeschichte durchlebt, die ihn nachhaltig prägte. Ich befragte ihn, quetschte ihn förmlich aus und war sehr bewegt von seinen Gedanken und Emotionen, an denen er mich teilhaben ließ. Damit begann mein Wunsch, seine Geschichte niederzuschreiben und meinen eigenen Anteil mit einfließen zu lassen. Aber wie sollte ich das anstellen? Nur auf meine Erfahrung in der Schule zurückblicken oder auf mein Bauchgefühl hören?
Ich begann einfach, nach bestem Wissen und meiner Intuition, seine Geschichte (mit seinem Einverständnis) aufzuschreiben, ließ aber immer wieder für längere Zeit meine geschriebenen Notizen in der Schublade liegen, weil ich mich nicht traute, sie jemand anderem zu zeigen – bis mich irgendwann mein Mut packte und ich sie einer guten Freundin zum Probelesen gab. Zu meiner großen Überraschung war sie völlig angetan von meiner halbfertigen Geschichte, dem Schreibstil und ihrer literarischen und mir eigenen Sprache. Sie ermutigte mich, das Werk zu Ende zu bringen, um es anschließend zu veröffentlichen. Also zog ich mich eine Weile zurück und schrieb Tag und Nacht, fünf Wochen am Stück, bis die erste Rohfassung meines ersten Romans stand.
Doch damit war noch längst nicht alles getan, und ich ahnte noch nicht, auf welches Vorhaben ich mich eingelassen hatte. Und überhaupt: Wer denn in Gottes Namen sollte mein Buch überhaupt lesen wollen?Nachdem ich mich ausführlich mit den Notwendigkeiten, die damit verbunden waren, beschäftigt hatte, fasste ich den Plan, meinen Weg zu gehen. Ich machte jedoch allerhand Anfängerfehler, indem ich meiner Ungeduld folgte, ohne wesentliche Dinge zu beachten; so ignorierte ich ein Lektorat, sondern beanspruchte lediglich ein Korrektorat, das eine liebe Freundin, so gut sie konnte, in unendlicher Geduld (ich konnte echt nervig sein) erledigte. Ich hatte keine Ahnung von dem Umgang mit dem korrekten Zitieren, von Urheberrechten und sonstigen rechtlichen Bestimmungen, vom richtigen Erstellen einer Literaturverzeichnisses, und schon längst nicht davon, was alles sonst noch nötig wäre, um nach der Veröffentlichung mein Buch erfolgreich auf den Markt zu bringen. Ich verbrachte endlose Monate damit, gründlich die Rohfassung zu strukturieren, ihr ein Konzept zu geben und sie inhaltlich und sprachlich zu optimieren, nebenbei immer wieder gründlich zu recherchieren. Alles mehr oder weniger nach Hörensagen oder was in Blogbeiträgen dazu geschrieben wurde. Ich war wie besessen davon, zu einem exakt festgesetzten Datum das fertige Buch zu veröffentlichen und drangsalierte damit alle Beteiligten. Noch bevor ich sie mit Content befüllen konnte, ließ ich eine Homepage erstellen, denn man sagte mir, dass die unheimlich wichtig sei. Noch gar nicht hatte ich mit dem Handwerkszeug des Schreibens beschäftigt, weil ich mir einbildete, es alleine richtig zu machen ohne irgendwelche Ratschläge von anderen Coaches folgen zu müssen. Ein großer Fehler, denn das Weiterkommen stockte mit einem Mal. Welcher Verlag würde sich meiner annehmen? Oder alternativ – und das betrachtete ich zunächst als eine schlechtere Wahl – vielleicht im Selfpublishing veröffentlichen? Zu alledem fehlte noch ein passendes Cover, dass ich mir dann – hundert Mal geändert – von meinen Kindern erstellen ließ. Die sozialen Medien waren mir bis dahin schnuppe, ebenso wie das Marketing.
Doch dann stieß ich nach einem halben Jahr auf die Bookademy von Sandra Maier, die mich rettete. Hier machte ich eine mehrmonatige Autorenausbildung und lernte Vieles dazu, von dem ich nie geahnt hätte, dass es dies alles im Zusammenhang damit, ein guter und erfolgreicher Autor werden zu können, gab und grundlegend für eine Autorenkarriere sei. Schritt für Schritt musste ich meine Arroganz aufgeben, es alleine schaffen zu können, und ich lernte anzunehmen, dass ich nun wusste, was ich zuvor nicht gewusst hatte, aber dachte, es sowieso nicht nötig gehabt zu haben. Und was glaubt ihr? Es kam noch eine Menge neue Arbeit auf mich zu, die mich noch ein weiteres halbes Jahr kostete, bis ich dann endlich meinen ersten Probedruck in den Händen hielt, stolz wie Oskar!
Was ich im Einzelnen gelernt hatte, sei noch nicht verraten. Wer von euch auch Autor*in werden möchte und daran interessiert ist, von meinen Erfahrungen zu lesen und bestenfalls zu lernen:
Wartet auf meinen kommenden Block am nächsten Sonntag; da werde ich es euch Punkt für Punkt wissen lassen…
Euer Samuel
Mein Autorenleben durch´s Jahr
29.01.2024 – Samuel Coenigsberg
Ich stelle mich euch gerne erst einmal vor:
Ich bin gebürtiger Rheinländer mit erweitertem Migrationshintergrund, überzeugter freikirchlicher Christ mit großer Freude am Predigen und am Gestalten von Gemeinde . Vor allem aber bin ich ein stolzer schwuler Vater von zwei erwachsenen Kindern, bin mittlerweile im sechsten Lebensjahrzehnt und lebe mit meinem wunderbaren Ehemann und unserem Senioren-Katzenpaar in Berlins Umland nahe der brandenburgischen Grenze.
Neben meiner Leidenschaft am Autorendasein sind meine kulinarischen Leidenschaften: Nussschokolade (am liebsten des deutschen Herstellers, der mit „L“ beginnt) , und im Sommer Eis mit Sahne. Aber auch die österreichische Küche mit ihrem Kaiserschmarrn, dem Germknödel und dem Herzhaften, das auf den Tisch gebracht wird, ist für mich wie eine Sinfonie für die Gaumenfreuden. Leider bin ich Raucher, dem es schwerfällt, das endlich mal sein zu lassen. Ich liebe den Sommer und das Meer mit seinem sanften Rauschen. Schnee ist nicht so meins.
Thriller schaue ich gerne und grusele mich dabei, mit den entsprechenden Mediatheken und Anbietern bin ich schon auf Du und Du, sofern es meine Zeit zulässt. In der Musik bin ich Fan von allem aus den 80er- und 90er- Jahren, meine Lieblingssänger*innen sind Peter Cornelius, Hermann van Veen, Barbra Streisand, Lara Fabian. Ich liebe deutsche und österreichische sowie französische Liedermacher und Chansonniers (dass ich auch Helene Fischer sehr mag, schreibe ich hier vorsichtshalber erst gar nicht aus Angst vor Shitstorm! Sehr gerne lese ich historische Familiengeschichten und Klassiker, ihnen voran Thomas Mann, Sir Peter Ustinov, Günter Grass, Irvin Shaw, Isaac Bashevis Singer und andere. Insgesamt gerne poetische Literatur, aus der ich meinen Wortschatz vergrößern kann.
Meine Freunde bezeichnen mich als einfühlsam, hilfsbereit, humorvoll, aufgeschlossen und dass sie auf mich zählen können. Zudem die engsten unter ihnen als jemanden, der manchmal anstrengend sein kann, weil er bis aufs Blut ausdiskutiert (typisch jüdische Eigenschaft), bis er endlich versteht, um dann ins Handeln zu gehen. Meine Marotten sind außerdem, dass ich ständig wie ein zerstreuter Professor alles Mögliche verlege (Brille, Autoschlüssel, Hausschlüssel, Handy, Feuerzeug) und am liebsten 1000 Dinge auf einmal erledigen möchte. Deswegen plane ich neuerdings nach der Eisenhower-Methode, um etwas mehr Struktur hineinzubekommen. Das hilft mir, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und vor allem, meinem Ziel als erfolgreicher Autor näherzukommen.
Ich arbeite co-therapeutisch in einem Bereich der Psychiatrie und liebe meinen Beruf, durch den ich viele bereichernde Erfahrungen machen darf und schon so einige wunderbare Persönlichkeiten kennenlernen durfte. Nicht zuletzt durch sie habe ich einen großen Einblick in viele menschliche Lebenskrisen gewonnen und schöpfe aus deren Geschichten, um eigene romanhafte Biografien schreiben zu können und sie in meinen Romanen zu lebendigen Figuren entstehen zu lassen. Meine Inspirationen für meine Bücher bekomme ich durch vielfältige Begegnungen im Alltag und mit der Beschäftigung tagespolitischer Geschehen, die sich in unserer Welt abspielen.
Ich stehe ein für die Rechte und Anerkennung der LGBTQ, Menschenrechte allgemein, Liebe unter den Menschen, Enttabuisierung und klare Benennung von Ungerechtigkeiten. Ich bin absoluter Gegner von Rassenhass, Antisemitismus, Diskriminierung und dem „Schwimmen mit dem Strom“.
Mein Alltag spielt sich so ab, wie er es bei den meisten tut: früh aufstehen (obwohl ich liebend gerne länger schlafe), zur Arbeit mit den Öffis fahren, dort meiner beruflichen Berufung nachgehe, am späten Nachmittag wieder heimkehre (ich habe eine Vollzeitstelle). Tja, und was dann?
Ich will es euch gerne erzählen: Zunächst ein Plausch beim Abendessen, das mein begabter Ehemann vorbereitet hat (er kocht und backt himmlisch), dann – sofern es die Zeit hergibt – eine meiner drei Lieblingsserien schauen (Rosenheim Cops, Soko Wismar, Notruf Hafenkante) und Nachrichten ansehen, meist mit Bad News. Dagegen habe ich übrigens Good News abonniert, um mir einen anderen positiven Blick auf die Welt zu gönnen. Wenn ich nicht schon zu erschöpft bin, befasse ich mich mit diversen Kursen und Schulungen für Autoren, um mich weiterzuqualifizieren (Buchmarketing, KI, Instagram,..), bediene die Sozialen Medien, so gut ich kann (eigentlich bin ich ein digitaler Neandertaler!);))
Am wichtigsten ist mir jedoch das Schreiben. Dafür nehme ich mir vor allem an den Wochenenden (nach dem regelmäßigen Hausputz) und an freien Tagen Zeit. Auch hier benutze ich Strategien, um am Ball zu bleiben, damit meine Geschichten Gestalt annehmen. Doch nicht nur das Schreiben ist dazu unerlässlich, sondern ebenso gründliche Recherche, auf die ich sehr viel wert lege, damit ich euch alles mit „Hand und Fuß“ abliefern kann. Das erfordert manchmal viel Zeit, und hie und da bin ich auf Recherche-Reise, um mich mit den Menschen, die ich portraitiere, persönlich zu unterhalten. Besonders bin ich an den politischen und geschichtlichen Hintergründen interessiert und an allem, was sich hinter der Person verbirgt. Daher dauert es in der Regel zwei Jahre, bis ein neues Buch von mir herauskommt. Nach der abgeschlossenen „Que(E)rflug“ -Dilogie arbeite ich derzeit an einem Roman über einen Menschen, der durch einen speziellen Freund animiert, andere Menschen maßgeblich zu ihrem Wohlsein und ihrer Heilung begleitet. Lasst euch überraschen!
Podcasts sind als Nächstes in Planung, aber bitte gebt mir dafür noch etwas Zeit, denn derzeit bin ich mit dem Verfassen meiner Hörbücher, mit Übersetzungen der bisherigen Veröffentlichungen und mit Lesungen beschäftigt.
Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid!
Bis zum nächsten Mal.
Euer Samuel